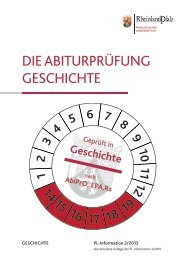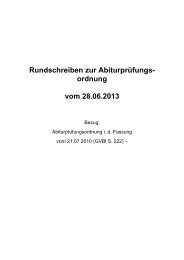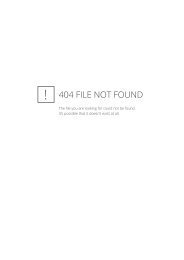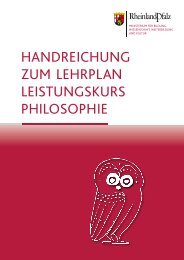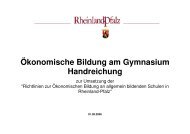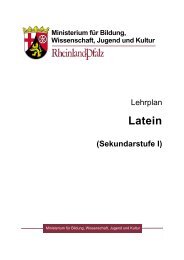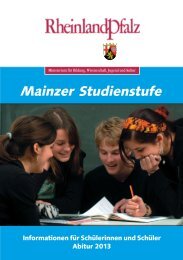handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wesenheiten (Werte) nach Maß gabe ihrer „Werthöhe“<br />
in der Welt zu realisieren, so ist das „außerhalb seiner<br />
selbst“ seiende, sich selbst überschreitende Subjekt<br />
nach Sartre geradezu „verurteilt, frei zu sein“, weil<br />
keine „Es senz“, also auch kein Wert-Sein, kein Telos<br />
und schon gar keine metaphysi sche Bestimmung<br />
seiner „Existenz“ vorausgeht, der Mensch also in die<br />
Welt geworfen ist und deshalb für sein Handeln in<br />
radikaler Weise allein verantwortlich ist. In einem<br />
spontanen, präreflexiven Entwurf, der den je konkreten<br />
Wollens- und Handlungsakten vorausgeht, setzt<br />
sich das Subjekt als zeitli ches, auf die Zukunft ausgerichtetes<br />
autonomes und damit ethisch handelndes<br />
Ego, dessen je konkretes Handeln von der Evidenz<br />
begleitet ist, als wäre das indi viduelle Handeln exemplarisch<br />
für das Handeln der ganzen Menschheit,<br />
„als ob bei jedem Handeln die ganze Menschheit den<br />
Blick auf sein Handeln gerichtet hätte und sich nach<br />
sei nem Handeln richten würde“. Und weil der Verantwortung<br />
tragende Mensch den „Blick“ der anderen<br />
auf sich gerichtet fühlt, er also weiß, dass sein Handeln<br />
bedeutsam ist für das Wohl der gesamten Menschheit,<br />
ist sein Handeln vom Gefühl der „Angst“ begleitet<br />
– von der Angst falsch zu entscheiden (Jean-Paul<br />
Sartre: Der Existentialismus ist ein Humanismus).<br />
Dieses Verständnis der Subjektivität als Intersubjektivität<br />
rechtfertigt es, den Existenzialismus als Humanismus<br />
zu charakterisieren.<br />
Unter radikalem Humanismus versteht Erich Fromm<br />
eine „globale Philosophie, die das Eins sein der menschlichen<br />
Rasse, die Fähigkeit des Menschen, die eigenen<br />
Kräfte zu entwickeln, zur inneren Harmonie und zur<br />
Errichtung einer friedlichen Welt zu gelangen, in den<br />
Vorder grund stellt“. Diesen radikalen Humanismus<br />
versteht Fromm explizit auch als „nicht-theisti sche<br />
Mystik“ (Fromm: Ihr werdet sein wie Gott. Eine radikale<br />
Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition),<br />
weil der Mensch am Ende der Geschichte der<br />
Religion den im Laufe dieser Geschichte immer mehr<br />
verinnerlichten Gott als das eigene Selbst zu begreifen<br />
lernt (Fromm: Die Kunst des Liebens). Fromm deutet<br />
Geschichte als einen fort schreitenden Prozess des<br />
Auf tauchens der Freiheit des Individuums aus vorindividualisti<br />
schen Gesellschaftsformen heraus, die<br />
Sicherheit und Sinnorientierung gaben, gleichzeitig<br />
aber den Freiheitsspielraum des Indivi duums einschränkten.<br />
Der moderne Mensch hat zwar – dies<br />
ist sein Dilemma – seine individu elle Freiheit „von“<br />
religiösen, politischen, moralischen und wirtschaftlichen<br />
Autoritäten erlangt, ohne aber die in ihm liegende<br />
Möglichkeit, alles Le bendige tätig „zu“ lieben<br />
(„Biophilie“), erlernt zu haben. Vielmehr wird die<br />
mögliche Verwirkli chung des menschlichen Selbst<br />
bedroht durch die latent anwesende „Furcht vor der<br />
Freiheit“, die sich in „Fluchtmechanismen“ manifestiert:<br />
in der sadistisch-masochistischen Perversion<br />
des autoritären Charakters, in der Destruktivität<br />
und im Konformismus (Fromm: Die Furcht vor der Freiheit).<br />
Der moderne Götzendienst des Menschen ist<br />
Ausdruck seiner krankhaften Art und Weise, mit der<br />
ihn überfordernden existenziellen Ursitu ation seines<br />
Ich-Seins umzu gehen. Die Geschichte des Menschen<br />
steht – so Fromm – auf dem Spiel. Es sei zu befürchten,<br />
dass die Geschichte, die mit einem Akt des „Ungehorsams“<br />
(von Adam und Eva) be gonnen habe, mit<br />
einem dem Ungeist der „Nekrophilie“ entspringenden<br />
Akt des „Gehorsams“ en de: nämlich mit der atomaren<br />
Selbstvernichtung der menschlichen Rasse (Fromm:<br />
Der Un gehorsam als ein psychologisches und ethisches<br />
Problem).<br />
5. Fragen der aktuellen anthropologischen<br />
Diskussion<br />
Die aktuelle anthropologische Diskussion ist dadurch<br />
gekennzeichnet, dass die empirischen Wissenschaften<br />
das Bild vom Menschen nachhaltig zu bestimmen<br />
scheinen. Der Philosophie komme – so die Meinung<br />
einer Reihe von Autoren – in dem interdisziplinären<br />
Diskurs der ver schiedenen empirischen Wissenschaften<br />
nur noch die Rolle der Moderation zu. Dazu sei<br />
die Philosophie in besonderer Weise qualifiziert, da<br />
sie vor dem Hintergrund ihrer Geschichte über den<br />
Horizont der entscheidenden Metafragen und Kategorien<br />
verfüge. Ausgehend von den Er kenntnissen<br />
empirischer Wissenschaften, wie der Evolutionsbiologie<br />
und der Evolu tionspsycho logie, der Neurobiologie<br />
und der Neuropsychologie, der Entwicklungspsychologie,<br />
der Kyberne tik, den Kognitionswissenschaften,<br />
versuchen andere Autoren, eine neue philo sophische<br />
An thropologie zu begründen.<br />
Wolfgang Welsch steht stellvertretend für eine<br />
aktuelle anthropologische Reflexion, die den abendländischen<br />
Anthropozentrismus überwinden will.<br />
Welsch sieht sich in der Kontinuität zu einer Reihe<br />
42<br />
Anthropologie