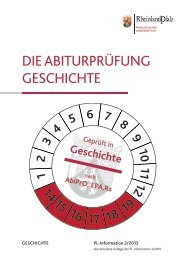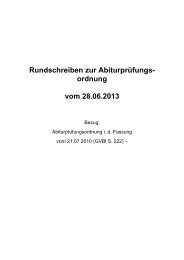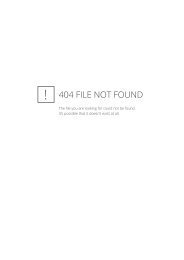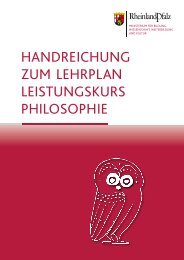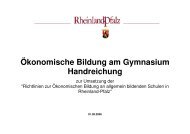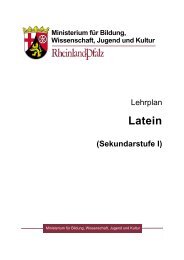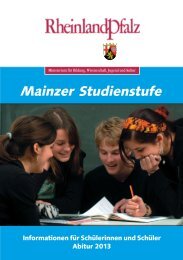handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
von Denkern der Moderne, deren Fragen er <strong>zum</strong><br />
Teil synoptisch zusammen stellt (Theodor W. Adorno:<br />
Wozu noch Philosophie?; Günther Anders: Die Antiquiertheit<br />
des Men schen; Michel Foucault: Die<br />
Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften;<br />
Alan M. Turing: Computing Machinery<br />
and Intelligence; Hans Moravec: Geist ohne<br />
Körper – Visionen von der reinen Intelligenz u. a.). Die<br />
Annahme des Dualismus von „animalischer Natur“<br />
und „supranaturaler Vernunft“ sei nicht aufrecht zu<br />
erhalten, da ein solcher Dualismus mit den Ergebnissen<br />
der evolutionären Anthropologie nicht vereinbar<br />
sei. Welsch vertritt keinen „natura listischen Reduktionismus“,<br />
sondern sieht im „Paradigma der Emergenz“<br />
eine Möglichkeit der Erklärung, wie höhere Entitäten<br />
auf niederen aufbauen, ohne dass die komplexere<br />
höhere Entität auf die sie fundierende reduziert<br />
werden kann (Wolfgang Welsch: Anthropologie im<br />
Umbruch – Das Paradigma der Emergenz). Relevant<br />
sei dieses Paradigma vor allem im Kontext der Diskussion<br />
um das in der „Philosophy of Mind“ umstrittene<br />
Personalitätsprinzip, weil unter Heranziehung dieses<br />
Paradigmas gegen den „Epiphänomenalismus“ argumentiert<br />
werden könne. Nach Welsch ist es aber<br />
nicht aufrecht zu erhalten, dass Vernunft ein Privileg<br />
des Men schen sei, da diese gleichsam aus der Natur<br />
hervorgehe. Deshalb sei der seit der Antike vertre tene<br />
„Anthropozentrismus“ nicht haltbar. Änderungen im<br />
humanen Selbstverständnis seien des halb an<strong>zum</strong>ahnen:<br />
(1) Der Mensch ist biologisch „kein Sonderwesen“.<br />
Tiere sind grundsätzlich von der Vernunft nicht ausgeschlos<br />
sen; der Unterschied zwischen Tier und<br />
Mensch ist nur gra dueller Natur. (2) Der Mensch ist<br />
nicht das Ende der biologischen Evolution. Vor allem<br />
aber ist die biologische Natur des Men schen „in<br />
einem zuvor nicht für möglich gehaltenen Ausmaß<br />
ver änderbar“. Eine Wesens bestimmung des Menschen<br />
ist deshalb nicht möglich, die „vermeintli chen Konstanten<br />
menschlicher Natur sind keine“. (3) Mentale<br />
Zustände, Intelligenz, Selbst bewusstsein, Kreati vität<br />
sind überhaupt nicht exklusives Privileg tierischer<br />
oder gar menschlicher Natur, sondern können prinzipiell<br />
auch Attribute künstlicher Intelligenz sein<br />
(Welsch: Wandlun gen im huma nen Selbstverständnis).<br />
In der tierethischen Diskussion vertritt Peter Singer<br />
einen Präfe renzutilitarismus, der den menschlichen<br />
„Speziesismus“ zurückweisen will und somit auch den<br />
Tieren Rechte zuspricht. Zwei Kriterien werden dabei<br />
im Kontext tierethischer Argumen ta tion von Singer<br />
in Anspruch genommen: Empfindungsfähigkeit und<br />
Selbstbewusstsein. Aus der Empfindungsfähigkeit<br />
von Lebewesen resultiert das Recht von Lebewesen,<br />
dass ihre Interessen zu berücksichtigen sind; aus<br />
dem Selbstbewusstsein folgt ein Recht auf Leben,<br />
das Menschen, die nicht über Selbstbewusstsein und<br />
somit Personalität verfügen, nicht be sitzen, während<br />
eini gen Menschenaffen ein solches Recht zukommt<br />
(Peter Singer: Prakti sche Ethik). Robert Spaemann<br />
sieht in tierischem Verhalten „Vorformen menschlicher<br />
Sub jektivität“, was bedeuten soll, dass – ungeachtet<br />
der Sonderstellung des Menschen, an der<br />
Spaemann festhält – eine Grenzziehung zwischen<br />
Tierheit und Menschheit Schwierigkeiten bereitet<br />
(Robert Spaemann: Funkkolleg praktische Philosophie/<br />
Ethik. Studienbegleitbrief 6).<br />
In der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der<br />
Neuro- und Kognitionswissenschaften wen det sich<br />
die moderne Philosophie des Geistes dem bereits<br />
in der philosophischen Tradi tion dis kutierten Leib-<br />
Seele-Problem und den sich daraus ergebenden<br />
Erkenntnisproble men, ethi schen Fragestellungen<br />
und anthropologischen Konsequenzen zu. Das Leib-<br />
Seele-Problem wird in der Philosophie des Geistes als<br />
eine Frage nach dem Zusammenhang von neuronalen<br />
Prozes sen und „mentalen Eigenschaften“ (bzw. „mentalen<br />
Substanzen“) disku tiert. Nach Thomas Nagel<br />
sind im Wesentlichen drei Antwortversuche <strong>zum</strong><br />
Leib-Seele-Pro blem zu unterscheiden: „Physikalismus“<br />
(„Materialismus“), „Dualismus“ und „Identitätstheorie“.<br />
Für den Physikalismus sind alle psychischen<br />
Phänomene kausal unwirksame Epiphänomene<br />
physikalischer Prozesse des Gehirns, somit letztlich<br />
„Zustände des Gehirns“. Der Dualismus begreift das<br />
Verhältnis von Gehirn und Seele als Wechselwirkung<br />
selbst ständiger Entitäten, deshalb kann er davon<br />
aus gehen, dass die „psychischen Vorgänge“ kau sal<br />
wirksam sind, und damit die Wil lensfreiheit voraussetzen.<br />
Die Identitäts theorie schließlich geht davon<br />
aus, dass psychische Vorgänge und physikalische<br />
Prozesse des Gehirns identisch sind, verschiedene<br />
Aspekte der selben Sache, einer nur erlebbaren subjektiven<br />
„Innenperspektive“ und einer auch von außen<br />
erfassbaren, objektiven Seite, weshalb Nagel diese<br />
Theorie auch als „Doppelaspekttheorie“ be zeichnet.<br />
Nagel, der sich selbst als Physikalist begreift, spielt<br />
mit einem interessanten Gedan kenexperiment auf<br />
Anthropologie 43