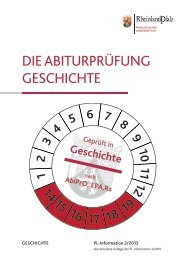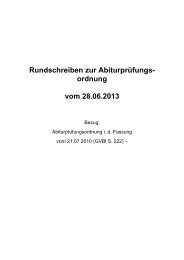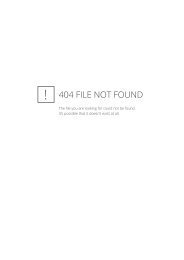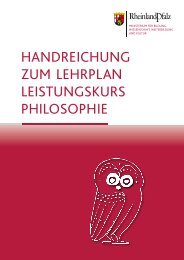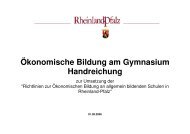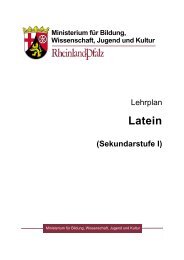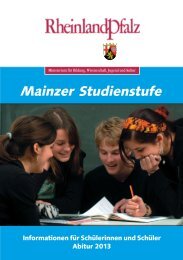handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gottfried Wilhelm Leibniz setzt mit seiner Kritik<br />
am erkenntnistheoretischen Grundsatz „Ich denke,<br />
also bin ich“ von Descartes an: „Primitive Tatsachenwahrheiten<br />
aber gibt es eben soviele, wie es unmittelbare<br />
Perzeptionen oder, um mich so auszudrücken,<br />
‘Bewusstseine’ [=Bewußtseinsinhalte] gibt. Ich bin mir<br />
nicht nur meiner selbst als des denkenden Subjekts,<br />
sondern auch meiner Gedanken bewusst, und ebenso<br />
wahr und gewiss, als ich denke, wird dieses oder jenes<br />
von mir gedacht. Man kann somit die primitiven Tatsachenwahrheiten<br />
passend auf folgende zurückführen:<br />
‘Ich denke’ und ‘Mannigfaltiges wird von mir gedacht’.<br />
Hieraus folgt nicht nur, dass ich existiere, sondern auch,<br />
dass ich auf mannigfache Art be stimmt bin“ (Gottfried<br />
Wilhelm Leibniz: Animadversiones in partem generalem<br />
Principiorum Cartesianorum, Gerh. IV, § 357).<br />
Leibniz veranschaulicht seine Position zur Geist-<br />
Materie-Problematik in seiner Schrift Mona dologie<br />
sehr anschaulich anhand eines Gedankenexperiments:<br />
Als winziger Mensch betritt man das Gehirn, so wie<br />
man die riesige Maschinenhalle einer Mühle betritt.<br />
Wenn man die sen Inhalt untersuchte, so würde man<br />
nur „Stücke finden, die einander stoßen“, niemals<br />
je doch etwas, womit man eine „Perzeption“ erklären<br />
könnte. Das „Unkörperliche“ könne man darin nicht<br />
finden. Alles was „Perzeptionen“ und „Begehren“ hat,<br />
bezeichnet Leibniz als „einfache Substanzen“, „geschaffene<br />
Monaden“ oder „Seelen“. Alle „einfachen<br />
Substanzen“, auch „Entelechien“ genannt, tragen<br />
in sich eine bestimmte Vollkommenheit, sind „unkörperli<br />
che Automaten“. Der Begriff „Seele“ steht<br />
für Perzeptionen, die „distinkter und von Erinnerung<br />
begleitet“ sind (Leibniz: Monadologie, Abschnitt 19).<br />
Selbst wenn wir Augen hätten, die so durchdringend<br />
wären, um die winzigsten Teile eines Kör pers zu<br />
sehen, und man sich vorstellte, zwischen diesen zu<br />
spazieren, könnte man zwar se hen, dass die Maschine<br />
die „schönsten Dinge“ hervorbrächte, doch niemals<br />
kön nten Maschinen Bewusstsein haben (Leibniz:<br />
Briefwechsel mit Bayle 1702). Leibniz nennt ausdrücklich<br />
die Augen, Geruchs- und Tastorgan als Mittel der<br />
Perzeption (Mona dologie, Abschnitt 25). Dennoch<br />
schließt er eine körperliche Beteiligung an geistigen<br />
Tätig keiten aus. Alles Existierende besteht dieser<br />
Theorie zufolge im Kern aus Monaden (Atome der<br />
Natur: Mo nadologie, Abschnitt 6 und 9); sie können<br />
nicht untergliedert werden, nicht geteilt, es kann ihnen<br />
auch nichts hinzugefügt werden: „Monaden haben keine<br />
Fenster, durch die et was ein- oder austreten könnte“<br />
(Monadologie, Abschnitt 7). Jede Monade ist ein Spiegel<br />
des Universums (Monadologie, Abschnitt 83).<br />
Leibniz vertritt einen parallelen Dualismus. Die Seele<br />
in ihrer Beziehung <strong>zum</strong> Körperlichen veranschaulicht<br />
er in einem Gedankenexperiment: Man stelle sich<br />
zwei synchron lau fende Uhren vor (Körper und Seele).<br />
Ihre Synchronizität kommt dadurch zustande, dass<br />
Gott in „vorausschauender Kunst vom Anfang der<br />
Schöpfung an“ beide Substanzen in „so voll kommener<br />
und geregelter Weise“ geschaffen hat, dass das Zusammenwirken<br />
von Körper und Geist aufgrund einer<br />
„prästabilierten Harmonie“ eingerichtet wurde, worin<br />
sich, wie Leibniz an Clark schreibt, eine „ewige Staunenswürdigkeit“<br />
ereigne. Gott hat, wie Leibniz in<br />
„Drôle de pensée“ <strong>zum</strong> Ausdruck bringt, die Fähigkeit,<br />
gleichzeitig alles in einem Blick zu erkennen, den Kosmos<br />
in all seinen Elementen und deren Beziehungen<br />
untereinan der. Eine augenblickliche Erfassung aller<br />
Dinge und derer Relationen bezeichnet Leibniz als<br />
„intuitiven Akt“. Es handelt sich um ein Erkenntnisvermögen,<br />
das die Fähigkeit des Men schen übersteigt;<br />
dieser hat hierzu keinen Zugang. Leibniz entwickelt<br />
ein Stufenmodell der Erkenntnis. Grundsätzlich ist<br />
eine Erkenntnis klar oder dunkel: Klar ist sie, wenn<br />
es gelingt, eine vorgestellte Sache wiederzuerkennen,<br />
dunkel, wenn dies nicht gelingt. Eine klare Erkenntnis<br />
kann aber auch verworren sein, wenn es nicht gelingt,<br />
eine Sache deutlich von einer anderen zu unterscheiden,<br />
und wenn ein Urteil zwar gefällt, aber nicht<br />
genau identifiziert werden kann, sondern in einem<br />
„je ne sais quoi“ ver bleibt. Urteile werden durch „die<br />
einfachen Sinne“ getroffen. Ich kann beispielsweise<br />
eine Gestalt als schön, wohl geformt erkennen, aber<br />
nicht angeben, worauf ich das Urteil stütze. Deutlich<br />
ist eine Erkenntnis, wenn eine Sache von anderen<br />
unterschieden werden kann und Merkmale der Unterscheidung<br />
deutlich benannt werden können, doch<br />
auch dann ist diese Erkenntnis noch nicht „adäquat“.<br />
Eine adäquate klare Erkenntnis vermag eine Analyse<br />
aller Merkmale vorzunehmen bis in die letzten einfachen<br />
nicht mehr analysierbaren Gegeben heiten.<br />
Dem menschlichen Erkenntnisvermögen sind Grenzen<br />
gesetzt. So vermag der Mensch bei spielsweise nicht<br />
sehr komplexe Strukturen zu erkennen, es sind solche,<br />
94<br />
Erkenntnistheorie – Philosophie des Geistes