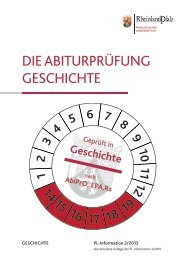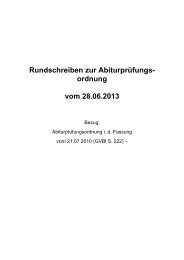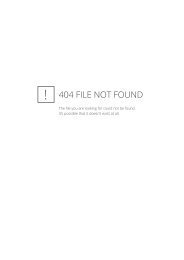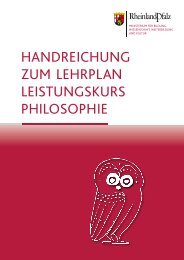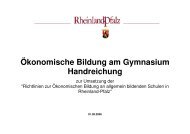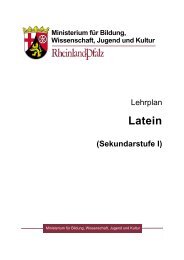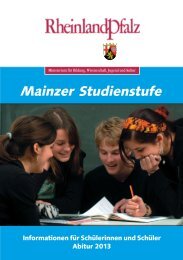handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Objektivität). Für die Konstruktivisten ergeben sich<br />
daraus gesellschaftliche, politische und kulturelle<br />
Konsequenzen. Für Paul Watzlawick erhält der Begriff<br />
der „Ver antwortung“ eine neue Bedeutung, und zwar<br />
insofern, dass sich mit der konstruktivistischen Denkweise<br />
die Toleranz gegenüber „Wirklichkeiten anderer“<br />
entwickelt; der Einzelne über nimmt Verantwortung<br />
für die Wirklichkeit, die er selbst konstruiert, und<br />
kann sie nicht ande ren „in die Schuhe schieben“ (Paul<br />
Watzlawick: Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit).<br />
Heinz von Foerster ergänzt den Begriff Verantwortung<br />
im konstruktivistischen Sinne dahin gehend,<br />
dass das „beliebte Gesellschaftsspiel, sich der Verantwortung<br />
zu entziehen“, brü chig wird: Die Berufung<br />
auf „Umwelt“ (Behaviorismus) oder „Gene“ (Soziobiologie)<br />
greift nicht mehr, und auch „die genialste<br />
Strategie“, sich der Verantwortung zu entziehen –<br />
„die Berufung auf Objektivität“ – wird damit obsolet.<br />
Die Trennung des Beobachters vom Beobachteten<br />
kann nicht mehr vorausgesetzt werden (Heinz von<br />
Foerster: Entdecken oder erfinden. Wie lässt sich<br />
Verstehen verstehen?).<br />
Das Interesse an empirischen Daten und Theorien<br />
hat im 20. Jahrhundert durch Psycho linguistik und<br />
Neurowissenschaften die erkenntnistheoretische Reflexion<br />
entscheidend be reichert und zu einem neuen<br />
Aufschwung innerhalb der Philosophie des Geistes<br />
geführt. Die Flut von Veröffentlichungen zur aktuellen<br />
Auseinandersetzung der Philosophie des Geistes mit<br />
experimentellen und empirischen Wissenschaften<br />
zeigt den Versuch, mit neuen Begrifflichkeiten neu<br />
gewonnene Einsichten darzulegen. Die Neurowissenschaften<br />
greifen, wie Olaf Breidbach in seiner<br />
Schrift Die Materialisierung des Ichs darlegt, ihrerseits<br />
auf eine „umfassende Tradition“ zurück, besonders im<br />
Hinblick auf Begriffe und Konzepte, und sie sind weit<br />
davon entfernt, mit ahistorischen Begriffen zu arbeiten.<br />
Die Herausforderung ergibt sich demnach einerseits<br />
daraus, dass Begriffe aus der Philosophie und<br />
naturwissenschaftli che Begriffe neu ausgehandelt<br />
werden müssen, und anderseits daraus, dass gängige<br />
Me thoden der einzelnen Wissenschaften in gemeinsamen<br />
Projekten sinnvoll zu verknüpfen oder gar völlig<br />
neu zu überdenken sind. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass inzwischen eine internationale Zusammenarbeit<br />
der Wissenschaften entstanden ist, sodass philosophische<br />
Texte <strong>zum</strong>eist in englischer Sprache verfasst<br />
werden. Daraus folgt, dass empirische Praxis und philosophische<br />
Metatheorie begrifflich eine Ebene finden<br />
müssen, um in ihrer Zusam menarbeit zu akzeptablen<br />
Lösungen zu kommen. So wird in aktuellen philosophischen<br />
Schriften von „mentalen Phänomenen“ gesprochen,<br />
im Gegensatz zu „physischen Phänomenen“.<br />
„Mental“ heißt in diesem Sinne also „nicht-phy sisch“.<br />
Peter Bieri erläutert in Analytische Philosophie des<br />
Geistes die Verwendung des Begriffs „mental“. Dieser<br />
umfasse „psychisch“, „geistig“, und „seelisch“. „Mental“,<br />
so Bieri, ist der Begriff, der „am wenigsten festgelegt“<br />
zu sein scheint, der weniger geläufig ist. So<br />
bietet er sich als „terminus technicus“ an, der alle<br />
Phänomene umfasst, die der ontologische Dua lismus<br />
als „nicht-physisch“ ansieht, z. B. ein breites Spektrum<br />
von „emotionalen Zuständen“ wie Zorn bis zu<br />
„kognitven Phänomenen“ wie Gedanken und Meinungen.<br />
Ein weiterer Grund liegt darin, dass in englischsprachigen<br />
Texten dieser Terminus gängig ist.<br />
3. Dualistische Erkenntnismodelle und das Leib-<br />
Seele-Problem<br />
Antike dualistische Erkenntnismodelle wie z. B. dasjenige<br />
des Platon gehen von einer klaren Trennung<br />
von Körper und Seele bzw. Geist aus. Im Gedankenexperiment<br />
des Höhlengleichnisses von Platon wird<br />
die Verknüpfung von Er kenntnis, Körper und Geist anschaulich<br />
dargelegt. Mit der Seele erkennt der Mensch.<br />
Diese ist immateriell, ihren Ursprung hat sie im Reich<br />
der Ideen, und nach dem Tod des Menschen kehrt sie<br />
auch dahin wieder zurück, um im Verlauf des kosmischen<br />
Kreislaufs von dort aus wieder ins Diesseits zu<br />
gelangen. Gefangen im Körper („soma/sema“) strebt<br />
sie nach Wahr heit („aletheia“), die sie im Reich der<br />
Ideen bereits schaute und im Eintritt ins Diesseits<br />
zu Teilen wieder vergisst (Platon: Politeia). Das Vergessen<br />
der Seele beim Eintritt in das irdi sche Leben<br />
beschreibt Platon sehr anschaulich in einem Rückgriff<br />
auf eine mythologische Erzählung in der Politeia: Hier<br />
wird das Vergessen der Seele in eine Symbolik des<br />
Wassers, des Flusses „lethe“, geleitet. Die im Diesseits<br />
angekommenen durstigen Seelen trinken aus dem<br />
Fluss „lethe“ und vergessen die in ihrer Präexistenz, in<br />
der „idea“ geschauten Wahrheiten. Martin Heidegger<br />
übersetzt „aletheia“ auf begriffsgeschichtlicher Basis<br />
mit „Unverborge nes“ (Martin Heidegger: Vom Wesen<br />
92<br />
Erkenntnistheorie – Philosophie des Geistes