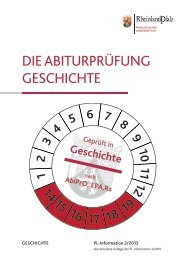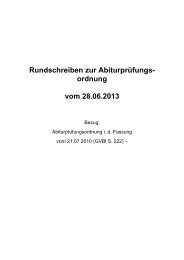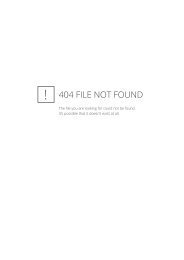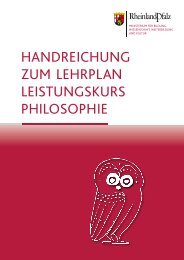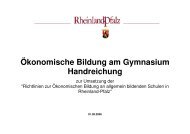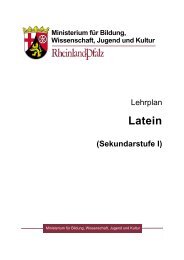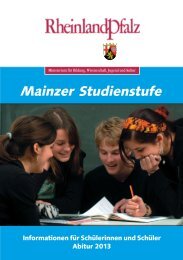handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sche Strukturen verfügt, die er bereits in der Sinnlichkeit<br />
festmacht. Empfindungen werden nämlich nicht<br />
ungeordnet dem erkennenden Subjekt dargeboten,<br />
sondern in den apriorischen Formen der Anschauung<br />
(Raum und Zeit). Der Zusammenhang von rezeptiver<br />
Wahrnehmung und Denken stellt sich bei Kant wie<br />
folgt dar: „Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen<br />
durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert<br />
werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittelst<br />
der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben,<br />
und sie allein liefert uns Anschauun gen; durch den<br />
Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen<br />
Begriffe. [ …] Die Wirkung eines Gegenstandes<br />
auf die Vorstellungsfähigkeit, sofern wir von<br />
demselben affiziert werden, ist Empfindung. Diejenige<br />
Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch<br />
Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte<br />
Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt<br />
Erscheinung“ (Kant: KrV, A 19, B 33).<br />
Kant unterscheidet somit rezeptive Wahrnehmung<br />
von spontanem Denken. Der zunächst unbestimmte<br />
Gegenstand, der unserer Sinnlichkeit aufgrund einer<br />
Affektion gegeben ist, wird von dem transzendentalen,<br />
kategorialen Verstand durch eine intellektuelle<br />
Synthesis gedacht. Dies ist nach Kant ein notwendiges<br />
Denkverfahren, um logische Operationen auf<br />
zeitliche Ereignis folgen anzuwenden. „Wenn A – so B“<br />
ist nach Kant ein „hypothetisches Urteil“, also eine<br />
hypothetische Denkform. Nur so ist eine systematische<br />
Erfahrung von zeitlichen Abläufen möglich<br />
(Kausalprinzip). Doch was heißt es nun im Sinne von<br />
Kant, dass ein „Gegenstand unter einem Begriffe“<br />
enthalten sei? Zur Beantwortung dieser Frage wählt<br />
Kant ein Bild: „So hat der empirische Begriff eines<br />
Tellers mit dem reinen geometrischen eines Zirkels<br />
Gleich artigkeit, indem die Rundung, die in dem ersteren<br />
gedacht wird, sich im letzteren anschauen lässt.“ „Reine<br />
Verstandesbegriffe“, so KANT, sind völlig ungleich mit<br />
empirischen Anschauungen und können dort niemals<br />
angetroffen werden. Wie Verstandesbegriffe auf Erscheinungen<br />
angewandt werden können, erklärt Kant<br />
durch „eine transzendentale Doktrin der Urteilskraft“.<br />
Es muss, so Kant, „ein Drittes“ geben, was „einerseits<br />
mit der Kategorie, andererseits mit der Erschei nung in<br />
Gleichartigkeit stehen muß“. Dieses „Dritte“ ist das<br />
„transzendentale Schema“, was einerseits eine nichtempirische<br />
„vermittelnde Vorstellung“, andererseits<br />
aber sinnlich ist. Man könnte annehmen, dass dieses<br />
Schema eine Art Bild wäre, doch nach Kant ist ein<br />
Bild ganz deutlich von diesem Schema zu unterscheiden:<br />
„In der Tat liegen unsern reinen sinnli chen Begriffen<br />
nicht Bilder der Gegenstände, sondern Schemate<br />
<strong>zum</strong> Grunde.“ Interessant ist der Begriff „Seele“, den<br />
Kant in diesem Zusammenhang verwendet: „Dieser<br />
Schematismus unseres Verstandes, in Ansehung der Erscheinungen<br />
und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene<br />
Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre<br />
Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten,<br />
und sie unverdeckt vor Augen legen werden“ (Kant:<br />
KrV A 140, 141, B 180).<br />
Der Philosoph und Psychologe Otto Selz, der von<br />
den Nationalsozialisten in Auschwitz er mordet<br />
wurde, hat die Schematheorie im 20. Jahrhundert<br />
weiterentwickelt. Es sind nach Selz Elemente von<br />
strukturierten Denkabläufen, die an Prozessen der<br />
Wissensaktualisie rung beteiligt sind (Otto Selz:<br />
Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs). Einige<br />
moderne materialistische Ansätze gehen davon<br />
aus, dass geistige Zustände im Grunde physikalische<br />
Zustände sind und aus diesem Grunde auch mit<br />
physikalischen Ter mini beschrieben werden müssen,<br />
wie beispielsweise Francis Crick, der dem radikalen<br />
Re duktionismus zugerechnet wird. Ob wir, wie Kant<br />
vermutet, den Geheimnissen der Natur unseres Gehirns<br />
auf die Spur kommen oder den „Weltknoten“ im<br />
Sinne Schopenhauers lösen werden, ist noch nicht<br />
end gültig entschieden. Schlimm sei es, sagt Paul M.<br />
Churchland etwa 200 Jahre später in sei nem Buch<br />
Die Seelenmaschine, dass wir, auch wenn uns noch<br />
angemessene Konzepte und theoretische Voraussetzungen<br />
fehlten, immer noch der alten Auffassung<br />
anhingen, dass Bewusstsein überhaupt niemals verstehbar<br />
sei. Nach Churchland lässt sich inzwischen<br />
auf der Basis experimenteller und theoreti scher Methoden<br />
die Kluft zwischen Geist und Materie „überspannen“.<br />
Mit Hinweis auf Bild gebende Verfahren<br />
(PET u. fNMR) und der Theorie neuronaler Netze sei<br />
nachweisbar, dass geistige Aktivitäten „untrennbar<br />
an die anatomischen und physiologischen Gegebenheiten<br />
gebunden“ sind. „Geist“ spielt sich somit auf<br />
der Grundlage physikalischer und physiologi scher<br />
Prozesse ab. Genau hier glaubt Churchland durch die<br />
96<br />
Erkenntnistheorie – Philosophie des Geistes