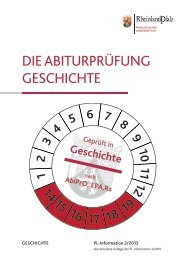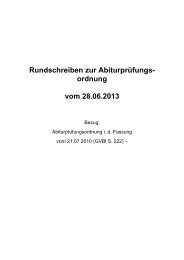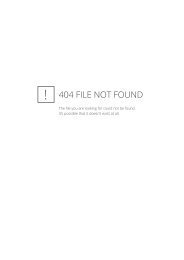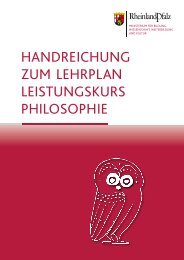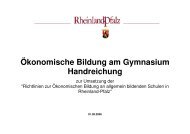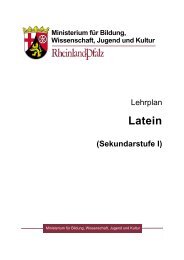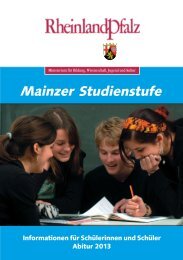handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erkenntnis und Interesse). Im technisch-wis senschaftlichen<br />
Denken drücke sich ein Herrschafts interesse<br />
aus, im hermeneutischen ein Ver ständigungsinteresse,<br />
im Denken der kriti schen Wissenschaft ein emanzipatorisches<br />
Interesse. Im herrschaftsfreien Diskurs<br />
wer den gesellschaftlich geltende Werte und Wahrheit<br />
verhandelt, eine Objektivität der Natur hat somit<br />
nur relative Gültigkeit innerhalb dieses Diskurses.<br />
Vittorio Hösle sieht in der Wissenschaftsgeschichte<br />
eine Zunahme des Herrschaftsanspruches des Menschen.<br />
Noch im antiken Denken sei das Verhältnis<br />
zwischen Mensch und Natur ein harmoni sches. Im<br />
Laufe der Wissenschaftsgeschichte werde Natur immer<br />
mehr durch den Herr schaftsanspruch der neuzeitlichen,<br />
von René Descartes initiierten Verabsolutierung<br />
des Sub jektes in radikaler Weise verdinglicht.<br />
Folge dieser Verdinglichung sei der Verlust des Eigenwertes<br />
von Natur, ihrer Würde, ihre Entzauberung<br />
zugunsten einer techni schen Kontrolle und Ausbeutung<br />
der Natur <strong>zum</strong> (vermeintlichen) Wohle des<br />
konsumierenden Menschen. Dieser Machtanspruch<br />
des Menschen führe nicht nur zur Zerstörung der<br />
Natur, sondern zu einer die Existenz der Menschheit<br />
bedrohenden ökologischen Krise (Vittorio Hösle:<br />
Philosophie der ökologischen Krise).<br />
5. Zum Begriff der Hermeneutik<br />
Wilhelm Dilthey sieht in seinem Werk Die Entstehung<br />
der Hermeneutik den Unter schied zwi schen Naturwissenschaften<br />
und Geisteswissenschaften in ihrer<br />
unterschiedli chen Methode be gründet. Naturwissenschaften<br />
erklären Vorgänge in der Natur, indem sie<br />
naturgesetzliche Zu sammenhänge erkennen. Geisteswissenschaften<br />
hingegen ver stehen den Sinn und<br />
die Sinn zusammenhänge von Zeichen: Texte, Kunstwerke,<br />
ge schichtliche Epochen sind traditionelle<br />
Gegenstände hermeneutischer Auslegung. Wäh rend<br />
das Verstehen Sinndeutung eines histo risch einmaligen<br />
Gegenstandes ist, zielt die Naturwissenschaft<br />
primär nicht darauf, die Indivi dualität eines Gegenstandes<br />
in den Blick zu nehmen, sondern intendiert<br />
die Erkenntnis allge meingültiger Gesetze. Die hermeneutische<br />
Vernunft sieht hingegen erst in einem<br />
zweiten Schritt das Individuelle als Repräsentant<br />
eines Allgemeinen, etwa ein bestimmtes Kunstwerk<br />
als reprä sentatives Beispiel einer Epoche. Bereits<br />
Friedrich Schleiermacher erkennt, dass Verstehen<br />
Einfühlung und Nacherleben des Fremdpsychischen<br />
voraussetzt. So können wir etwa Handlun gen einer<br />
Person verstehen, indem wir deren Handlungsgründe<br />
nachvollziehen, uns also in die andere Person hineinversetzen.<br />
Hans-Georg Gadamer macht darauf aufmerksam,<br />
dass bereits jeder Dialog komplexe Verstehensleistungen<br />
beinhaltet, ohne die er misslingen<br />
muss. Die Handlungen eines Menschen zu erklären,<br />
heißt hingegen, ihn <strong>zum</strong> „Objekt“ naturwissenschaftli<br />
cher Erkenntnis zu machen. Das hermeneutische<br />
Verstehen vollzieht sich dabei in einem zirku lären<br />
Prozess, weil der Bezug <strong>zum</strong> Ganzen im Verstehensprozess<br />
vorausgesetzt ist. Das Be sondere, etwa ein<br />
Gedicht des Barock, wird mit einem Vorverständnis,<br />
das der Interpret besitzt, in den Blick genommen,<br />
so dass das Besondere als Besonderes eines Ganzen<br />
wahrgenommen wird. Dieser Wech sel des Verstehens<br />
des Teils durch das Ganze und des Ganzen durch das<br />
Teil wird seit Dilthey als hermeneutischer Zirkel<br />
bezeichnet. „Wer einen Text verstehen will, vollzieht<br />
immer ein Entwerfen. Er wirft sich einen Sinn des<br />
Ganzen voraus, sobald sich ein erster Sinn im Text<br />
zeigt“, schreibt Hans-Georg Gadamer in Wahrheit und<br />
Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik<br />
(Grundzüge einer Theorie der hermeneutischen<br />
Erfahrung). Nach Gadamer setzt der hermeneutische<br />
Prozess ein „Darinstehen“ in der Tradition voraus und<br />
darf deshalb auch nicht als eine „Handlung der Subjektivität“<br />
missverstanden werden. Die „Sinnerwartung“<br />
des Verstehenden geschieht aus einer Haltung<br />
heraus, die bereit ist, „sich etwas sagen zu lassen“.<br />
Ziel des Verstehensprozesses ist die „Teilhabe am<br />
gemeinsamen Sinn“, der im Dialog mit der Tradition<br />
aufscheint und in der „Horizontverschmelzung“<br />
erfahren wird.<br />
In Anlehnung an Royce formuliert Karl-Otto Apel,<br />
dass „Verstehen nicht als Konkurrenzunternehmen <strong>zum</strong><br />
Erklären verstanden werden darf, sondern eher als ein<br />
kognitives Komplementärphänomen zur szientifischen<br />
Erkenntnis objektiver Tatsachen“. Beide Phänomene<br />
müssten im Sinne einer „semiotisch transformierten<br />
Transzendental<strong>philosophie</strong>“ als Kommunikationshandlungen<br />
gedeutet werden, denen ein Interesse<br />
an „Sinnverständigung“ zu Grunde lägen. Regulatives<br />
Prinzip der intendierten Sinnverständigung sei das<br />
Apriori der „unbegrenzten Interpretationsgemeinschaft“,<br />
das jeder, der argumentiere, als „ideale Kon-<br />
78<br />
Wissenschafts<strong>philosophie</strong> – Natur<strong>philosophie</strong>