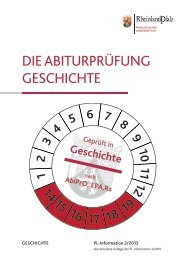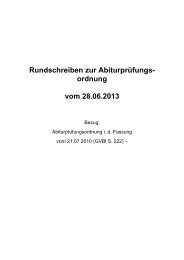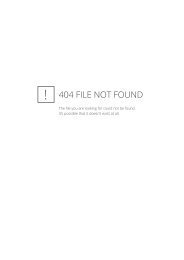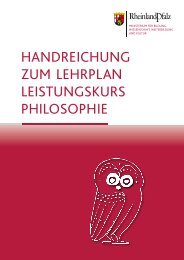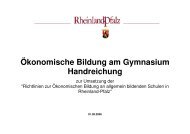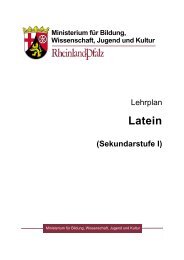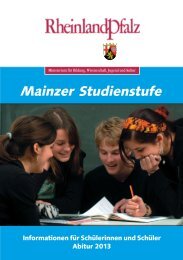handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Harmonie: „Wir waren Natur …, und un sere Kultur soll<br />
uns, auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit, zur<br />
Natur zurückführen.“<br />
Johann gottlieb Fichtes Philosophie tritt mit dem<br />
Anspruch auf, mit der Entdeckung der prä disjunktiven<br />
Ichheit die Einheit von theoretischer und praktischer<br />
Vernunft, die bei Kant nur postuliert wird, zu begründen.<br />
In der Grundlage der gesamten Wissenschafts lehre<br />
von 1794/95 wird die Unterscheidung von Theorie<br />
und Praxis auch erst im dritten Grundsatz erreicht.<br />
Während der erste Grundsatz in der Chiffre der absoluten<br />
„Tathandlung“ des Ich die absolute Vernunfttätigkeit<br />
und ihre Selbstsetzung <strong>zum</strong> Ausdruck zu<br />
bringen versucht, bringt der zweite Grundsatz die<br />
Urentfremdung der Negation der Tathandlung durch<br />
die Setzung von Nicht-Ich zur Anzeige. Ausgehend<br />
vom Grundsatz des Theoretischen deduziert Fichte<br />
die Verstandeskategorien, die bei Kant einfach nur<br />
der Kategorientafel des Aristoteles ent nommen<br />
werden. Sie sind im Kon text der Ausführungen Fichtes<br />
in der Grundlage Weisen, die Negation von „absolutem<br />
Ich“ im Theoretischen zu limitieren. Im Bereich<br />
der theoretischen Ver nunft bleibt aller dings die Negation<br />
durch die Nicht-Ich-Setzung so lange virulent, bis<br />
eine „un abhängige Tätigkeit“ benannt wird, die Entgegengesetzte,<br />
die unendliche Tätigkeit des Ich und ihre<br />
Begrenztheit, qualitativ so vereinigt, dass absolute<br />
Thesis und Antithesis unversöhnt ver söhnt zugleich<br />
Gültigkeit haben können: Im „Schweben der Einbildungskraft<br />
zwischen Un vereinbaren“ (Johann gottlieb<br />
Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre)<br />
entsteht die Zeit als Lebensform des Ich, auf deren<br />
Basis das Ich sich konstituiert und sich als praktischstrebendes<br />
in einer Unendlichkeit von Emanzipationsakten<br />
immer mehr seiner Bestimmung nä hert, reines<br />
Gattungswesen, absolute Existenz zu sein – ein Gedanke,<br />
der Fichte von Seiten Georg Wilhelm Friedrich<br />
Hegels in der Differenz schrift den Vorwurf der<br />
„schlechten Unend lichkeit“ einbrachte. Ohne das Bewusstsein<br />
von Handeln, heißt dies, ist im Sinne dieser<br />
Philoso phie überhaupt auch kein Bewusst sein möglich,<br />
weil Gegenstandskonstitution und Freiheitsakt<br />
sich genetisch wechselseitig bedingen. Die Freiheit<br />
ist somit nicht wie bei Kant bloße Idee der Vernunft,<br />
sondern Be dingung der Möglichkeit von Bewusstsein.<br />
Trotzdem ist für Fichte der Ide alismus theo retisch<br />
nicht dem „Dogmatismus“, welcher für Fichte ein<br />
Determinismus ist, überle gen, weil das Für-wahr-<br />
Halten erfahrener Freiheit nach Fichtes eigenem Bekunden<br />
ein Glaube ist, der letztlich einem Interesse<br />
der Vernunft an ihr selbst entspringt. Fichtes Früh<strong>philosophie</strong><br />
ist eine Metaphysik des Strebens, in der<br />
der Sinn der Welt darin gese hen wird, „Sphäre“ des<br />
Han delns zu sein (Fichte: Die Bestimmung des Menschen,<br />
Drit tes Buch). Die radikal praktische Wendung,<br />
die die idealistische, aber materialistisch umgedeutete<br />
Philosophie bei Karl Marx erfährt – „Die Philosophen<br />
haben die Welt nur verschieden interpretiert;<br />
es kommt darauf an, sie zu verändern“ (Karl Marx:<br />
Thesen über Feuerbach) –, wird von Fichtes Früh<strong>philosophie</strong><br />
ent scheidend vorbereitet. Wie bei Marx entfaltet<br />
der Mensch seine Wesensbestimmung in der<br />
Ar beit; wie bei Marx (und auch bei Ludwig Feuerbach)<br />
verwirklicht sich der Mensch, der sich als<br />
Gattungswesen versteht, geschichtlich. Die Frage<br />
nach der Kontinuität bzw. Diskontinuität in der<br />
Entwicklung der Philosophie Fichtes wird in der<br />
Forschung kontrovers diskutiert. Ontotheologi sche<br />
Denkansätze, die die Frage nach der Vermittlung des<br />
Einen und des Man nigfaltigen the matisieren, stehen<br />
ab der mittleren Phase des Denkens im Fokus des<br />
Inte resses. „Alles Man nigfaltige“ zurückzuführen auf<br />
„absolute Einheit“ und „das Eine“ (Fichte: Wissenschaftslehre<br />
1804, 2. Vortrag) als Prinzip des Mannigfaltigen<br />
zu sehen, sei Aufgabe der Philosophie. Das<br />
Sein finde sich als Dasein, dieses sei zu verstehen<br />
als Da des Seins, als dessen Existentialakt (Fichte:<br />
Wissenschaftslehre 1805). Das Sein, ein Begriff, der<br />
in der Früh<strong>philosophie</strong> keine über ragende Rolle spielt,<br />
wird in dialekti scher Weise als Transzendenz in der<br />
Immanenz des (abso luten) Wissens gesetzt. In der<br />
Spät<strong>philosophie</strong> rückt der Bildbegriff in den Mittelpunkt<br />
einer Da seinshermeneutik, in der sich das<br />
Ich als Bild des Absoluten versteht (vgl. zu den Ausführungen:<br />
Peter Baumanns: J. G. Fichte. Kritische<br />
Gesamtdarstellung seiner Philosophie; Wolfgang<br />
Janke: Fichte. Sein und Reflexion – Grundlagen der<br />
kritischen Vernunft).<br />
In Friedrich Wilhelm Joseph Schellings Philosophie,<br />
die das romantische Natur verständnis nachhaltig<br />
beeinflusst hat, wird der teleologische Ansatz Kants,<br />
dem in der Kritik der Urteilskraft ein bloß regulativer<br />
Gebrauch zukommt, metaphysisch umgedeutet.<br />
Natur ist für den frühen Schelling vorbewusste Ver-<br />
Metaphysik 63