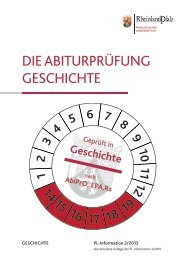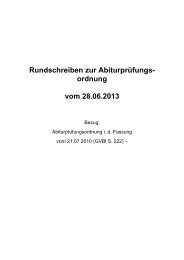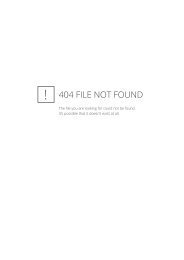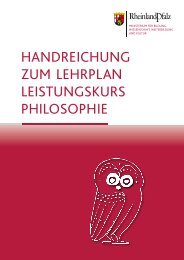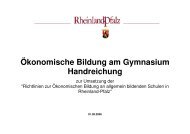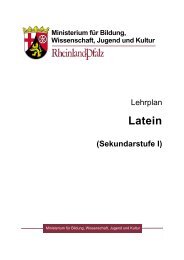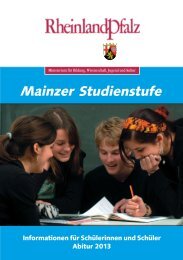handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
handreichung zum lehrplan leistungskurs philosophie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
demnach nicht auf Sprache und Spre chen, sondern<br />
sind zu verstehen „als Praktiken […], die systematisch<br />
die Gegenstände bil den, von denen sie spre chen“<br />
(Michel Foucault: Archäologie des Wissens).<br />
Foucault prägt den Begriff „Dispositiv“, um eine gesellschaftliche<br />
Struktur zu bezeichnen: Es handelt<br />
sich um ein „heterogenes Ensemble“ von Elementen<br />
wie Gebäuden, Institutionen, Gesetzen, wissenschaftlichen<br />
Aussagen, philosophischen Theorien,<br />
moralischen Grundsätzen und „Diskursen“. Wie ein<br />
Netz sind diese zahlreichen Elemente gesponnen,<br />
ein dynamisches Netz, in dem insbesondere Macht-,<br />
Wissens- und Sprachstrukturen auf allen Ebenen und<br />
in allen Ver netzungsstrukturen eine gesellschaftliche<br />
„Formation“ ausbilden. Dieses dynami sche Dispositiv<br />
wirkt „strategisch“ in gesellschaftlich-historischen<br />
Kontexten und verändert sich immer dann, wenn Verbindungen<br />
zwischen den Elementen brüchig werden,<br />
ein „Not stand“ eintritt. Diskurse partizipieren an „Gesagtem<br />
und Ungesagtem“ (also diskursiv und nichtdiskursiv).<br />
Wirksam als Verbindung zwischen den Elementen<br />
tragen Diskurse insbesondere dazu bei, Programme<br />
oder Praktiken zu rechtfertigen, Praktiken<br />
zu verschleiern („maskieren“), Rein terpretationen von<br />
Praktiken (Umdeutungen, Neu deutungen) vorzunehmen<br />
oder Positions wechsel und Funktionsveränderungen<br />
zu deklarieren. Es handelt sich dabei um<br />
„Manipula tionen von Kräfteverhältnissen“, um Veränderungen<br />
zu be wirken, die sehr unterschiedlicher<br />
Natur sein können, z. B. um Kräfteverhältnisse in eine<br />
ge wünschte Richtung zu bringen, an dere eventuell zu<br />
blockieren oder aber auch um bestehende Teile des<br />
Dispositivs zu stabili sieren. In all diesen Strategien<br />
wird Sprache verwandt, um Diskurse zwischen den<br />
Ele menten strategisch zu entwickeln in der Absicht,<br />
beispielsweise Wis sensbestände zu unter drücken<br />
oder auch zu fördern. Foucault spricht daher von<br />
„diskursivem Dispositiv“ (Foucault: Dispositive der<br />
Macht, Gespräch mit Lucette Finas). Diese Verknüpfungen<br />
und ihre historischen Entstehungsstrukturen aufzudecken<br />
ist das philosophische Projekt von Foucault.<br />
In seinem Werk „Ordnung der Dinge“ zeigt er anhand<br />
einer geradezu „archäolo gi schen“ Analyse das Zusammenwirken<br />
von (Schrift-)Sprache und Wissen auf,<br />
d. h. wie sich der schriftliche Diskurs in der Epoche des<br />
16. und frühen 17. Jahrhunderts ent faltete. Foucault<br />
stellt fest, dass Sprache (z. B. das enzyklopädische<br />
Projekt) in dieser Zeit als „globale kulturelle Erfahrung“<br />
zu verstehen ist. In seinem Werk Archäologie<br />
des Wissens legt Foucault dar, dass Diskurse in historischen<br />
Kontexten Be griffe gebildet haben, die kulturell<br />
die Vorstellung von Kontinuität und Linearität zu<br />
Grunde legten und somit Auffassungen verfestigten<br />
wie beispielsweise, Geschichte als Fortschritts geschichte<br />
zu sehen.<br />
Im aktuellen philosophischen Diskurs dauert die<br />
Sprachreflexion in Auseinandersetzung mit an deren<br />
Wissenschaften an, z. B. ist für die Philosophie des<br />
Geistes die sprachphilosophi sche Re flexion unerlässlich,<br />
gerade was Erklärungen wesentlicher Phänomene<br />
wie „Geist“ oder „Be wusstsein“ anbelangt.<br />
Welche Begriffe werden zur Beschreibung, zur Klärung<br />
des Phänomens „Geist“ verwandt? Die Frage danach,<br />
wie das mentale Phänomen „Geist“ be schrieben oder<br />
er klärt werden kann, führt u. a. zur Auseinandersetzung<br />
mit sprachphiloso phischen Ansätzen (be reits<br />
Gilbert Ryle hat sich sprachphilosophisch mit diesem<br />
Begriff auseinandergesetzt), z. B. der Begriffsentwicklung<br />
im Kontext von Deutungsversu chen und den<br />
damit kulturell ge wachsenen Vorstellungen von<br />
„Geist“ (vgl. Arbeitsbereich Er kenntnistheorie / Philosophie<br />
des Geistes). In diesem Sinne gehört es nach<br />
Thomas Metzinger einerseits zur Aufgabe der Philosophie<br />
des Geistes, die logische Struktur von Theorien<br />
des Phänomens „Geist“ zu untersuchen, andererseits<br />
gelte es – in Auseinan dersetzung mit den empirischen<br />
Wissenschaften – an der Entwicklung neuer begrifflicher<br />
Instrumente mitzuwirken, um dem aktuellen<br />
Stand der Wis senschaften gerecht zu werden (Thomas<br />
Metzinger: Das Problem des Bewusstseins). Letzteres<br />
ist aus folgenden Gründen besonders wichtig: Die<br />
Auseinandersetzung aktueller philosophischer Strömungen<br />
mit empi rischen Wissenschaften stellt im<br />
Hinblick auf die Trans- bzw. Interdiszipli narität die<br />
Frage nach der Terminologie der einzelnen Wissenschaften.<br />
Gerade hinsichtlich möglicher Erklä rungen<br />
von Phänomenen (z. B. „Bewusstsein“, „Geist“,<br />
„Seele“) und Beschrei bung von For schungsergebnissen<br />
scheinen Wissenschaften untereinander<br />
oftmals nicht „die gleiche Sprache“ zu sprechen,<br />
es kommt zu Verwirrungen bis hin zu Missverständnissen.<br />
Für den Philosophen Peter Bieri gilt es daher,<br />
eine „historische Neugierde für Begriffsgeschichten“<br />
zu entwickeln.<br />
Sprach<strong>philosophie</strong> 55