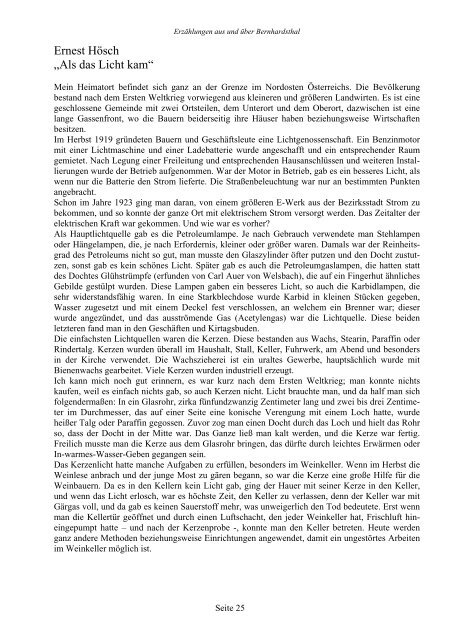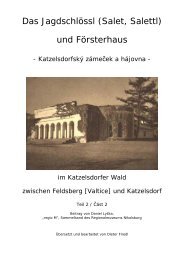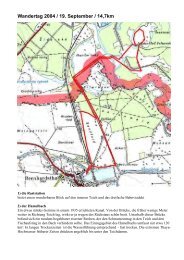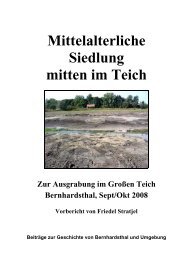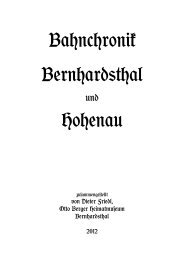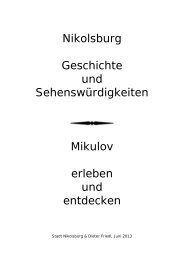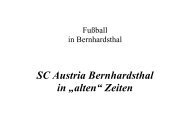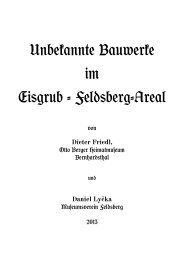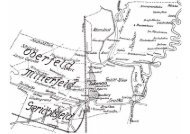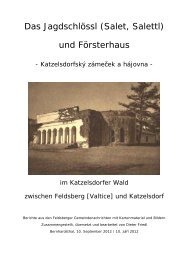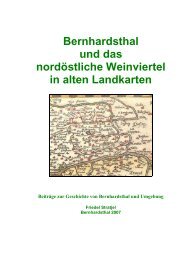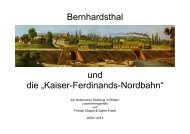Erzählungen und Berichte aus, von und über Bernhardsthal
Erzählungen und Berichte aus, von und über Bernhardsthal
Erzählungen und Berichte aus, von und über Bernhardsthal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Erzählungen</strong> <strong>aus</strong> <strong>und</strong> <strong>über</strong> <strong>Bernhardsthal</strong><br />
Ernest Hösch<br />
„Als das Licht kam“<br />
Mein Heimatort befindet sich ganz an der Grenze im Nordosten Österreichs. Die Bevölkerung<br />
bestand nach dem Ersten Weltkrieg vorwiegend <strong>aus</strong> kleineren <strong>und</strong> größeren Landwirten. Es ist eine<br />
geschlossene Gemeinde mit zwei Ortsteilen, dem Unterort <strong>und</strong> dem Oberort, dazwischen ist eine<br />
lange Gassenfront, wo die Bauern beiderseitig ihre Häuser haben beziehungsweise Wirtschaften<br />
besitzen.<br />
Im Herbst 1919 gründeten Bauern <strong>und</strong> Geschäftsleute eine Lichtgenossenschaft. Ein Benzinmotor<br />
mit einer Lichtmaschine <strong>und</strong> einer Ladebatterie wurde angeschafft <strong>und</strong> ein entsprechender Raum<br />
gemietet. Nach Legung einer Freileitung <strong>und</strong> entsprechenden H<strong>aus</strong>anschlüssen <strong>und</strong> weiteren Installierungen<br />
wurde der Betrieb aufgenommen. War der Motor in Betrieb, gab es ein besseres Licht, als<br />
wenn nur die Batterie den Strom lieferte. Die Straßenbeleuchtung war nur an bestimmten Punkten<br />
angebracht.<br />
Schon im Jahre 1923 ging man daran, <strong>von</strong> einem größeren E-Werk <strong>aus</strong> der Bezirksstadt Strom zu<br />
bekommen, <strong>und</strong> so konnte der ganze Ort mit elektrischem Strom versorgt werden. Das Zeitalter der<br />
elektrischen Kraft war gekommen. Und wie war es vorher?<br />
Als Hauptlichtquelle gab es die Petroleumlampe. Je nach Gebrauch verwendete man Stehlampen<br />
oder Hängelampen, die, je nach Erfordernis, kleiner oder größer waren. Damals war der Reinheitsgrad<br />
des Petroleums nicht so gut, man musste den Glaszylinder öfter putzen <strong>und</strong> den Docht zustutzen,<br />
sonst gab es kein schönes Licht. Später gab es auch die Petroleumgaslampen, die hatten statt<br />
des Dochtes Glühstrümpfe (erf<strong>und</strong>en <strong>von</strong> Carl Auer <strong>von</strong> Welsbach), die auf ein Fingerhut ähnliches<br />
Gebilde gestülpt wurden. Diese Lampen gaben ein besseres Licht, so auch die Karbidlampen, die<br />
sehr widerstandsfähig waren. In eine Starkblechdose wurde Karbid in kleinen Stücken gegeben,<br />
Wasser zugesetzt <strong>und</strong> mit einem Deckel fest verschlossen, an welchem ein Brenner war; dieser<br />
wurde angezündet, <strong>und</strong> das <strong>aus</strong>strömende Gas (Acetylengas) war die Lichtquelle. Diese beiden<br />
letzteren fand man in den Geschäften <strong>und</strong> Kirtagsbuden.<br />
Die einfachsten Lichtquellen waren die Kerzen. Diese bestanden <strong>aus</strong> Wachs, Stearin, Paraffin oder<br />
Rindertalg. Kerzen wurden <strong>über</strong>all im H<strong>aus</strong>halt, Stall, Keller, Fuhrwerk, am Abend <strong>und</strong> besonders<br />
in der Kirche verwendet. Die Wachszieherei ist ein uraltes Gewerbe, hauptsächlich wurde mit<br />
Bienenwachs gearbeitet. Viele Kerzen wurden industriell erzeugt.<br />
Ich kann mich noch gut erinnern, es war kurz nach dem Ersten Weltkrieg; man konnte nichts<br />
kaufen, weil es einfach nichts gab, so auch Kerzen nicht. Licht brauchte man, <strong>und</strong> da half man sich<br />
folgendermaßen: In ein Glasrohr, zirka fünf<strong>und</strong>zwanzig Zentimeter lang <strong>und</strong> zwei bis drei Zentimeter<br />
im Durchmesser, das auf einer Seite eine konische Verengung mit einem Loch hatte, wurde<br />
heißer Talg oder Paraffin gegossen. Zuvor zog man einen Docht durch das Loch <strong>und</strong> hielt das Rohr<br />
so, dass der Docht in der Mitte war. Das Ganze ließ man kalt werden, <strong>und</strong> die Kerze war fertig.<br />
Freilich musste man die Kerze <strong>aus</strong> dem Glasrohr bringen, das dürfte durch leichtes Erwärmen oder<br />
In-warmes-Wasser-Geben gegangen sein.<br />
Das Kerzenlicht hatte manche Aufgaben zu erfüllen, besonders im Weinkeller. Wenn im Herbst die<br />
Weinlese anbrach <strong>und</strong> der junge Most zu gären begann, so war die Kerze eine große Hilfe für die<br />
Weinbauern. Da es in den Kellern kein Licht gab, ging der Hauer mit seiner Kerze in den Keller,<br />
<strong>und</strong> wenn das Licht erlosch, war es höchste Zeit, den Keller zu verlassen, denn der Keller war mit<br />
Gärgas voll, <strong>und</strong> da gab es keinen Sauerstoff mehr, was unweigerlich den Tod bedeutete. Erst wenn<br />
man die Kellertür geöffnet <strong>und</strong> durch einen Luftschacht, den jeder Weinkeller hat, Frischluft hineingepumpt<br />
hatte – <strong>und</strong> nach der Kerzenprobe -, konnte man den Keller betreten. Heute werden<br />
ganz andere Methoden beziehungsweise Einrichtungen angewendet, damit ein ungestörtes Arbeiten<br />
im Weinkeller möglich ist.<br />
Seite 25