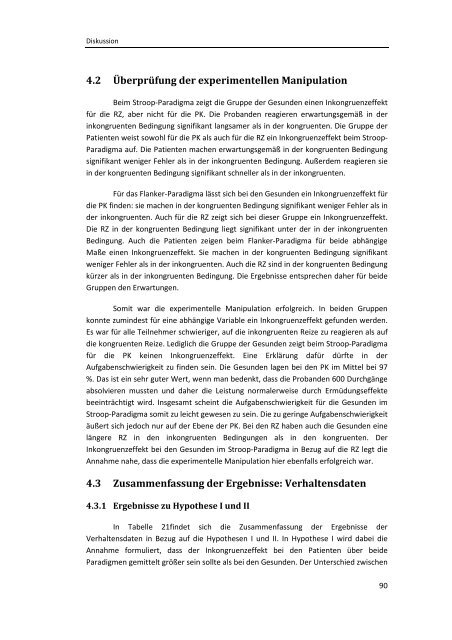PDF 5.373kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 5.373kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 5.373kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion<br />
4.2 Überprüfung der experimentellen Manipulation<br />
Beim Stroop-Paradigma zeigt die Gruppe der Gesunden einen Inkongruenzeffekt<br />
für die RZ, aber nicht für die PK. Die Probanden reagieren erwartungsgemäß in der<br />
inkongruenten Bedingung signifikant langsamer als in der kongruenten. Die Gruppe der<br />
Patienten weist sowohl für die PK als auch für die RZ ein Inkongruenzeffekt beim Stroop-<br />
Paradigma auf. Die Patienten machen erwartungsgemäß in der kongruenten Bedingung<br />
signifikant weniger Fehler als in der inkongruenten Bedingung. Außerdem reagieren sie<br />
in der kongruenten Bedingung signifikant schneller als in der inkongruenten.<br />
Für das Flanker-Paradigma lässt sich bei den Gesunden ein Inkongruenzeffekt für<br />
die PK finden: sie machen in der kongruenten Bedingung signifikant weniger Fehler als in<br />
der inkongruenten. Auch für die RZ zeigt sich bei dieser Gruppe ein Inkongruenzeffekt.<br />
Die RZ in der kongruenten Bedingung liegt signifikant unter der in der inkongruenten<br />
Bedingung. Auch die Patienten zeigen beim Flanker-Paradigma für beide abhängige<br />
Maße einen Inkongruenzeffekt. Sie machen in der kongruenten Bedingung signifikant<br />
weniger Fehler als in der inkongruenten. Auch die RZ sind in der kongruenten Bedingung<br />
kürzer als in der inkongruenten Bedingung. Die Ergebnisse entsprechen daher für beide<br />
Gruppen den Erwartungen.<br />
Somit war die experimentelle Manipulation erfolgreich. In beiden Gruppen<br />
konnte zumindest für eine abhängige Variable ein Inkongruenzeffekt gefunden werden.<br />
Es war für alle Teilnehmer schwieriger, auf die inkongruenten Reize zu reagieren als auf<br />
die kongruenten Reize. Lediglich die Gruppe der Gesunden zeigt beim Stroop-Paradigma<br />
für die PK keinen Inkongruenzeffekt. Eine Erklärung dafür dürfte in der<br />
Aufgabenschwierigkeit zu finden sein. Die Gesunden lagen bei den PK im Mittel bei 97<br />
%. Das ist ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass die Probanden 600 Durchgänge<br />
absolvieren mussten und daher die Leistung normalerweise durch Ermüdungseffekte<br />
beeinträchtigt wird. Insgesamt scheint die Aufgabenschwierigkeit für die Gesunden im<br />
Stroop-Paradigma somit zu leicht gewesen zu sein. Die zu geringe Aufgabenschwierigkeit<br />
äußert sich jedoch nur auf der Ebene der PK. Bei den RZ haben auch die Gesunden eine<br />
längere RZ in den inkongruenten Bedingungen als in den kongruenten. Der<br />
Inkongruenzeffekt bei den Gesunden im Stroop-Paradigma in Bezug auf die RZ legt die<br />
Annahme nahe, dass die experimentelle Manipulation hier ebenfalls erfolgreich war.<br />
4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse: Verhaltensdaten<br />
4.3.1 Ergebnisse zu Hypothese I und II<br />
In Tabelle 21findet sich die Zusammenfassung der Ergebnisse der<br />
Verhaltensdaten in Bezug auf die Hypothesen I und II. In Hypothese I wird dabei die<br />
Annahme formuliert, dass der Inkongruenzeffekt bei den Patienten über beide<br />
Paradigmen gemittelt größer sein sollte als bei den Gesunden. Der Unterschied zwischen<br />
90