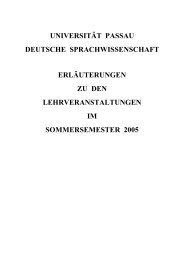Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
13.1.DIE KLASSISCHE PHILOLOGIE<br />
Die Klassische Philologie beschäftigt sich mit den literarischen Zeugnissen in griechischer<br />
und lateinischer Sprache, die aus der griechischen und römischen Antike stammen. Diese<br />
Zeugnisse umfassen aber nicht nur fiktionale Texte oder Dichtung, sondern auch Sachtexte<br />
wie historiographische Abhandlungen, philosophische Werke oder Lehrschriften, die sich<br />
beispielsweise mit rhetorischen oder landwirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Die<br />
Klassische Philologie unterteilt sich in die Gräzistik, die sich mit der griechischen<br />
Überlieferung befasst, und der Latinistik, die sich der lateinischen Überlieferung widmet 26 . Zu<br />
den Aufgaben der Klassischen Philologie gehört die Erarbeitung von textkritischen Editionen,<br />
Kommentaren, Übersetzungen und Lexika zur griechischen und lateinischen Sprache.<br />
13.1.1.Textkritik<br />
Die Beschäftigung mit einem antiken Text setzt eine zuverlässige Textgrundlage voraus. Da<br />
sich die Überlieferungsgeschichte im Bereich der antiken Texte sehr komplex gestaltet, stellt<br />
die Gewinnung des originalen Textbestandes eine der zentralen Aufgaben der Klassischen<br />
Philologie dar. Literarische Texte wurden in der Antike auf Papyrus und, zunehmend ab der<br />
römischen Kaiserzeit, auf Pergament überliefert. Bei der Herstellung von Papyrus wurde das<br />
Mark der Papyruspflanze verwendet, bei der Herstellung von Pergament wurden Tierhäute<br />
mit einer Kalklösung versetzt, gespannt und geglättet. <strong>Das</strong> Pergament weist eine höhere<br />
Beständigkeit als der Papyrus auf und kann wieder verwendet werden, indem die vorhandene<br />
Schrift abgeschabt wird. Die erstmalige Niederschrift eines Textes wird als Autograph<br />
bezeichnet. Es ist kein Exemplar eines Autographen überliefert. Nach der Fertigstellung der<br />
erstmaligen Niederschrift wurde ein antiker Text von sog. Kopisten immer wieder<br />
abgeschrieben. Die ältesten Abschriften stammen aus dem 4. und 5.Jhd.n.Chr. Es gibt darüber<br />
hinaus Papyrusfunde mit Textfragmenten von antiken Abschriften, von denen die ältesten<br />
Exemplare aus dem 4.Jhd.v.Chr. stammen. Von einem antiken Text sind in der Regel mehrere<br />
Abschriften überliefert, die zu unterschiedlichen Zeiten angefertigt wurden. Grundsätzlich<br />
wird zwischen der Hauptüberlieferung, die den Text vollständig oder fragmentarisch in<br />
direkter Form überliefert, und der Nebenüberlieferung, die den Text in Zitaten, Exzerpten,<br />
Paraphrasen, Übersetzungen oder Kommentaren indirekt wiedergibt, unterschieden. Ein<br />
großer Teil der überlieferten Handschriften stammt aus dem Mittelalter. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass jede Handschrift Fehler aufweist. Diese Fehler lassen sich zum einen auf<br />
Verschreibungen bei der Abschrift des Textes und andererseits auf bewusst vorgenommene<br />
Veränderungen des Kopisten zurückführen. Ziel der Textkritik ist die Aufdeckung der<br />
vorgenommenen Änderungen und die möglichst vollständige Wiederherstellung des<br />
originalen Wortlauts. <strong>Das</strong> Verfahren zur Wiederherstellung eines Textes, die constitutio<br />
textus, setzt sich aus drei Arbeitsschritten zusammen:<br />
- recensio: Die vorhandenen Handschriften werden gesammelt und miteinander<br />
verglichen, um Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Handschriften feststellen<br />
zu können. Die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den einzelnen Handschriften<br />
werden in einer Art Stammbaum, dem sog. Stemma, graphisch umgesetzt.<br />
Entscheidende Kriterien für die Rekonstruktion der Abhängigkeitsverhältnisse<br />
26 Vgl. P. Riemer/ M. Weißenberger/ B. Zimmermann, Einführung in das Studium der Latinistik (München<br />
1998) 9 – 11.<br />
64