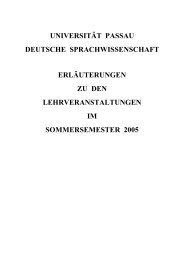Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- Falls es keinen "roten Faden" gibt, erfassen Sie diese Beobachtung möglichst genau,<br />
indem Sie Brüche in der Argumentation oder in der Erzählstruktur des Textes<br />
hervorheben.<br />
I.4. Inhaltsangabe<br />
- Fassen Sie den Inhalt des Textes knapp zusammen oder stellen Sie die wichtigsten<br />
Punkte heraus.<br />
II. TEXTARBEIT<br />
II.1. Betrachtungen zur Gattung des Textes, zum Verfasser und zu den Adressaten<br />
Um die Aussagen des Textes historisch einordnen zu können, ist es unerlässlich, einige<br />
Überlegungen zur Gattung der Quelle anzustellen. Vor diesem Hintergrund lassen sich auch<br />
sprachliche und stilistische Besonderheiten erklären.<br />
- Aus welchem Interesse wendet sich der Autor dem Gegenstand des Textes zu?<br />
- In welchem Verhältnis steht er zu den behandelten Inhalten? Welche Absichten<br />
verfolgt er?<br />
- An welchen Hörer- bzw. Leserkreis richtet sich der Text?<br />
Die fünf W’s der Altertumswissenschaften:<br />
• WER hat den Text verfasst/ das Objekt in Auftrag gegeben, erzeugt, benutzt, deponiert?<br />
Beispiele: Gehörte der Autor eines literarischen Textes dem Ritter- oder dem Senatorenstand an? War der<br />
Auftraggeber eines pompösen Grabmonumentes Senator oder Freigelassener des Kaisers?<br />
• WANN ist der Text/ das Objekt entstanden?<br />
Beispiele: Ist die Darstellung der Dakerkriege auf der Trajanssäule in Rom noch zu Lebzeiten Trajans selbst<br />
entstanden oder erst unter seinem Nachfolger Hadrian?<br />
• WO ist der Text/ das Objekt entstanden/aufgefunden worden?<br />
Beispiele: Ein attischer Krater wird in Südgallien aufgefunden, wie kommt er da hin? Arbeitet ein Historiker im<br />
Umkreis des Kaiserhofes oder in der Provinz?<br />
• WARUM ist der Text/ das Objekt entstanden?<br />
Beispiele: Handelt es sich bei einer Inschrift um eine Bau- oder eine Dedikationsinschrift? Hat der Autor eine<br />
Briefsammlung bewusst für eine Veröffentlichung gestaltet?<br />
• WIE ist der Text/ das Objekt gestaltet?<br />
Beispiele: Wie gliedert ein Autor seinen Stoff? Welche Fragen hat er an seine Primärquellen herangetragen?<br />
Augustus feiert die signa recepta ausgerechnet durch die Aufstellung eines Dreifußes vor dem Tempel des<br />
Apollo Palatinus, warum? 31<br />
II.2. Textkritik<br />
- Ordnen Sie den Text in den historischen Zusammenhang ein. Behandelt der Autor<br />
Zeitgenössisches oder beschreibt er Vergangenes?<br />
- Sind die überlieferten Angaben glaubwürdig oder lässt sich ablesen, dass bestimmte<br />
Sachverhalte absichtlich „verdreht“ werden?<br />
- Werden die Angaben der Quelle noch an anderer Stelle überliefert, und wenn ja, wie,<br />
in welchem Zusammenhang und mit welcher Intention?<br />
31 Diese Übersicht ist dem Tutorium Quercopolitanum, einem von dem Lehrstuhl für Alte Geschichte an der<br />
Universität Eichstätt entwickelten Leitfaden zum Althistorischen <strong>Proseminar</strong>, entnommen. <strong>Das</strong> Tutorium<br />
Quercopolitanum ist unter der Adresse http://www.gnomon.kueichstaett.de/LAG/proseminar/TutoriumEichstaett.pdf<br />
abrufbar.<br />
73