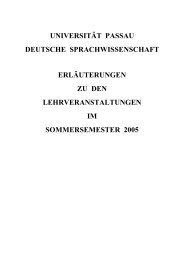Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
13.2.Die Epigraphik<br />
Bei der Epigraphik handelt es sich um die altertumswissenschaftliche Fachdisziplin, die sich<br />
mit den antiken Inschriften beschäftigt. Der Begriff ‚Epigraphik’ leitet sich von dem<br />
griechischen Verb epigráphein ab, das übersetzt ‚darauf schreiben’ bedeutet.<br />
13.2.1.Definition der Inschrift<br />
Unter den inschriftlichen Quellen werden alle schriftlichen Äußerungen verstanden, die nicht<br />
als Literatur oder auf Papyri und Münzen überliefert sind 33 .<br />
Die Inschriften sind nach den literarischen Quellen der zweite große Quellenkomplex, mit<br />
dem sich der Althistoriker auseinandersetzen muss. Den Inschriften kommt als<br />
Quellengattung ein sehr hoher Quellenwert zu, da das inschriftliche Material unmittelbar aus<br />
der Antike stammt und verschiedene Facetten aus allen Lebensbereichen widerspiegelt. Als<br />
überwiegend zeitgenössische und unmittelbare Dokumente bieten sie wichtige und oftmals<br />
einmalige Informationen. So sind Staatsverträge, Volksbeschlüsse, Senatsdekrete,<br />
Rechtssatzungen, Ehrungen, Stiftungen, Weihungen, Freilassungen oft nur als Inschriften<br />
überliefert. Sie ergänzen, erweitern und korrigieren das Wissen um die geschichtliche<br />
Wirklichkeit.<br />
13.2.2.Beschreibstoff und Technik<br />
Bei einem sehr großen Teil des inschriftlich erhaltenen Materials handelt es sich um in Stein<br />
gemeißelte Inschriften, was sich auf die Beschaffenheit des Inschriftenträgers zurückführen<br />
lässt. Steine sind einerseits relativ beständig gegenüber Umwelteinflüssen und wurden<br />
andererseits in späterer Zeit teilweise als Baumaterialien wiederverwendet, beispielsweise<br />
beim Bau einer Stadtmauer. Die Verwendung der Inschriftensteine als Baumaterialien wird<br />
als sekundäre Nutzung bezeichnet. Während der Stein bei der Erstnutzung als Beschreibstoff<br />
für die Inschrift fungierte, wird er bei der sekundären Nutzung zum Baustoff umfunktioniert.<br />
Inschriften liegen allerdings nicht nur auf Stein vor, sondern weisen verschiedenartige<br />
materielle Träger auf. Je nach Art des Beschreibstoffes erfordert die Gestaltung der Inschrift<br />
eine entsprechende Technik.<br />
Neben den behauenen Steinen stellen die sog. Bronzetafeln bzw. –täfelchen einen weiteren<br />
wichtigen Beschreibstoff dar. Der Inschriftentext wurde in die Bronzetafel bzw. das -täfelchen<br />
eingraviert. Eine wichtige Gruppe der auf Bronzetäfelchen eingravierten Inschriften bilden die<br />
sog. Militärdiplome/ diplomata militaria. <strong>Das</strong> römische Heer setzte sich in der frühen und<br />
mittleren Kaiserzeit aus den Legionen und den sog. Auxiliareinheiten/ Hilfstruppen<br />
zusammen. Die Soldaten, die in den Hilfstruppen kämpften, besaßen das römische<br />
Bürgerrecht, an das zahlreiche Privilegien geknüpft waren, in der Regel nicht. Die<br />
Hilfstruppensoldaten erhielten das römische Bürgerrecht nach einer ehrenhaften Entlassung<br />
aus dem durchschnittlich etwa 25 Jahre währenden militärischen Dienst. Bei den<br />
Militärdiplomen handelt es sich um beglaubigte Abschriften der kaiserlichen<br />
Bürgerrechtserlasse, die ursprünglich an einem zentralen Platz in Rom auf Bronzetafeln<br />
33 Vgl. W.Eck, Lateinische Epigraphik, abrufbar unter http://phil-fak.unikoeln.de/fileadmin/IfA/Alte_Geschichte/Reader_Einfuehrungsseminare/C2Epigraphik.pdf<br />
, eingesehen am 24.06.2009.<br />
75