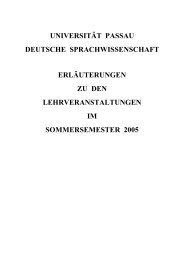Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Das althistorische Proseminar - Philosophische Fakultät - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stellen Fehler dar, die beim Abschreiben übernommen wurden, und äußere<br />
Faktoren wie die Beschaffenheit des Materials oder die verwendete Schriftart, die<br />
Hinweise auf das Alter einer Handschrift liefern. <strong>Das</strong> Stemma dient der<br />
Erschließung des Wortlautes der ältesten rekonstruierbaren Handschrift, dem sog.<br />
Archetypus. Diese Methode wurde unter der Voraussetzung entwickelt, dass jedem<br />
Kopisten nur eine einzige Handschrift zur Verfügung stand, die von ihm<br />
abgeschrieben wurde. Die Verwendung mehrerer Textvorlagen wird als<br />
Kontamination bezeichnet. Die Kontamination erschwert die Rekonstruktion der<br />
Abhängigkeiten, da sich der Kopist bei Abweichungen zwischen den<br />
verschiedenen Versionen entscheiden kann.<br />
- examinatio: Die Textfassung, die als älteste rekonstruierbare Handschrift über das<br />
Stemma erschlossen wurde, wird hinsichtlich inhaltlicher und sprachlicher<br />
Kriterien überprüft. Liegen für bestimmte Textstellen mehrere Versionen vor, stellt<br />
sich die Frage, welche Lesart den ursprünglichen Wortlaut wiedergibt.<br />
- emendatio: Haben sich bestimmte Textstellen als eindeutig fehlerhaft erwiesen,<br />
werden sie korrigiert. Der Korrekturvorschlag muss sowohl sprachlich als auch<br />
inhaltlich im Einklang zu dem Textganzen stehen. Die Korrekturvorschläge<br />
werden als Konjekturen bezeichnet. 27<br />
13.1.2.Die kritische Textausgabe<br />
<strong>Das</strong> Ergebnis der textkritischen Methode schlägt sich in der sog. kritischen Textausgabe<br />
nieder. Eine kritische Ausgabe präsentiert die durch die textkritische Methode gewonnene<br />
Textfassung, zeigt die Überlieferungsgeschichte des Textes auf und gibt Einblick in das<br />
methodische Vorgehen des Editors. Für die wissenschaftliche Analyse eines Quellentextes ist<br />
eine kritische Textausgabe daher unverzichtbar. Die kritische Ausgabe setzt sich aus drei<br />
Bestandteilen zusammen:<br />
- praefatio: Bei der praefatio handelt es sich um eine Einleitung des Herausgebers, in<br />
der alle verfügbaren Textzeugen erwähnt, beschrieben und zueinander in Beziehung<br />
gesetzt werden. Die Abhängigkeitsverhältnisse der Handschriften werden, wenn<br />
möglich, in einem Stemma graphisch umgesetzt. Die praefatio beschreibt die<br />
Überlieferungsgeschichte des Textes und enthält gegebenenfalls eine Bibliographie,<br />
die ältere Editionen und entsprechende Titel der Sekundärliteratur umfasst. Am Ende<br />
der praefatio erscheint in der Regel ein Verzeichnis mit den verwendeten<br />
Abkürzungen (vor allem mit den Siglen der Handschriften).<br />
- Text: Die kritische Ausgabe gibt den Text wieder, der nach der textkritischen Prüfung<br />
dem originalen Wortlaut am nächsten kommt. In dem Text können auch diakritische<br />
Zeichen erscheinen, die eine Unterscheidung zwischen dem originalen Wortlaut und<br />
vorgenommenen Änderungen ermöglichen 28 .<br />
- Kritische Apparate: Der textkritische Apparat gehört zu den obligatorischen<br />
Bestandteilen einer kritischen Textausgabe. Der textkritische Apparat erscheint jeweils<br />
am Ende einer Textseite. Er informiert über die Handschriften, die den im Text<br />
27 Vgl. J. Delz, Textkritik und Editionstechnik, in: F. Graf (Hg.), Einleitung in die lateinische Philologie<br />
(Stuttgart/ Leipzig 1997. Einleitung in die Altertumswissenschaft) 51 – 73.<br />
K. Dover, Textkritik, in: H. – G. Nesselrath (Hg.), Einleitung in die griechische Philologie (Stuttgart/ Leipzig<br />
1997. Einleitung in die Altertumswissenschaft) 45 – 58.<br />
Riemer/ Weißenberger/ Zimmermann, Einführung in das Studium der Latinistik, 53 – 72.<br />
28 Vgl. zu den diakritischen Zeichen Kapitel 11.2.5. Edition, 100.<br />
65