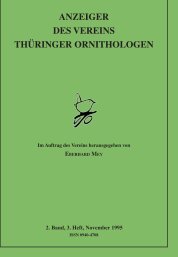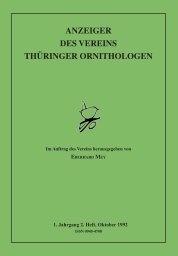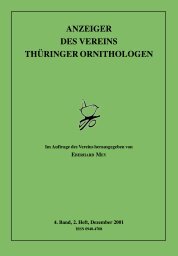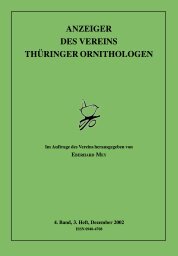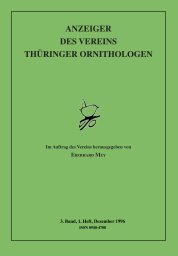anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
98 H. Münch: Zum Vorkommen <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels Loxia c. curvirostra im <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
kräftigt durch Funde von ebenfalls im <strong>Thüringer</strong><br />
Wald, aber zwischen 1980 und 1990 beringten<br />
Fichtenkreuzschnäbeln. Diese Bereicherung unserer<br />
Kenntnis verdanke ich Herrn F. H. BAUER in<br />
Eisfeld, der mir Kopien seiner Fundmitteilungen<br />
überließ, die hier eine nähere Betrachtung verdienen.<br />
Von den mit Ringen der Vogelwarte Hiddensee<br />
in der obengenannten Zeitspanne markierten<br />
Kreuzschnäbeln liegen insgesamt 17 Wiederfunde<br />
vor. Von diesen sind 9 Vögel besonders interessant,<br />
da sie nach Imal einem, 2mal 6, 3mal 10,<br />
2mal 14 und Imal sogar 41 (!) Monaten und nur 6<br />
bis 78 km vom Markierungsort entfernt, wiedergefunden<br />
wurden. Dabei lagen die Fundorte<br />
von 8 dieser Vögel ebenfalls im <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
und nur von einem im Fichtelgebirge. Von zwei<br />
weiteren Kreuzschnäbeln wurde einer nach 7<br />
Monaten und 196 km entfernt im Nordwesten,<br />
der andere nach 19 Monaten und 265 km entfernt<br />
im Südwesten Deutschlands wiedergefunden.<br />
Die Fundorte der übrigen 6 Vögel lagen 1 mal nach<br />
14 Monaten in Österreich, 2mal nach 4 bzw. 25<br />
Monaten in Italien, Imal nach 11 Monaten in<br />
Finnland, Imal nach 11 Monaten in der Schweiz<br />
und Imal nach 25 Monaten in Spanien.<br />
Von Interesse dürften auch drei im Fichtelgebirge<br />
markierte Kreuzschnäbel sein, von denen<br />
einer nach fünf, der andere nach 22 und der dritte<br />
nach 49 Monaten im <strong>Thüringer</strong> Wald wiedergefunden<br />
·wurden. Die Entfernung betrug jeweils<br />
70, 85 und 115 km.<br />
Von den genannten Ringfunden sind besonders<br />
wichtig die nach 1980 im <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
beringten 9 Kreuzschnäbel, welche alle bis auf<br />
eine Ausnahme (Fichtelgebirge) meist nach vielen<br />
Monaten dort auch wiedergefunden wurden<br />
sowie die drei im Fichtelgebirge markierten und<br />
im <strong>Thüringer</strong> Wald nachgewiesenen Vögel,<br />
ebenso der bereits 1971 im <strong>Thüringer</strong> Wald beringte,<br />
dort nach 14 Monaten wieder festgestellte<br />
Kreuzschnabel (Tab. 6, Nr. 3) und schließlich die<br />
bei den 1967 im Harz markierten und im <strong>Thüringer</strong><br />
Wald gefundenen Vögel. Sie sind Belege dafür,<br />
daß diese Kreuzschnäbel mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
mehr oder weniger regelmäßig sowohl<br />
weggezogen als auch wieder heimgekehrt sind<br />
in ihr Herkunftsgebiet, obwohl sie zwischenzeitlich<br />
vielleicht anderswo sogar gebrütet haben.<br />
Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche<br />
lokale Population <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Wal<strong>des</strong>, deren<br />
Areal vielleicht sogar bis zum Harz im Norden<br />
und bis zum Fichtelgebirge im Südosten reicht.<br />
Zu solcher Annahme berechtigen Ringfunde, die<br />
zeigen, daß Kreuzschnäbel vom <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
sowohl in das Fichtelgebirge als auch in den Harz<br />
hinüber bzw. umgekehrt von diesen Gebirgen zum<br />
<strong>Thüringer</strong> Wald wandern können. Diese Befunde<br />
stehen im völligen Widerspruch zu der Meinung<br />
von GATTER (1993), wonach es beim Fichtenkreuzschnabel<br />
keine festen Heimatgebiete und<br />
dementsprechend auch »keine lokalen Populationen«<br />
gibt.<br />
Zu den übrigen 6 Wiederfunden der nach 1980<br />
im <strong>Thüringer</strong> Wald beringten Kreuzschnäbel läßt<br />
sich über ihre Herkunft kaum etwas aussagen.<br />
Sie können sowohl heimischen Populationen angehört<br />
haben als auch aus anderen Gebieten gekommen<br />
sein. Lediglich für den in Finnland nachgewiesenen<br />
Vogel darf wohl mit einiger Sicherheit<br />
angenommen werden, daß er nach 11 Monaten<br />
wieder in sein Herkunftsland heimgekehrt war.<br />
Über das Verhalten <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels<br />
im weitesten Sinne ist in der Literatur bereits viel<br />
und ausführlich berichtet worden, dabei aber<br />
kaum oder überhaupt nicht das Füttern fremder,<br />
also nicht eigener Jungvögel erwähnt. Dies ist jedoch<br />
eine typische Verhaltensweise, wie es das hier<br />
(p. 90 f.) beschriebene Experiment bewiesen hat.<br />
Die Feststellungen über den Lebensraum und<br />
die Ernährungsweise der Kreuzschnäbel im Untersuchungsgebiet<br />
decken sich im wesentlichen<br />
mit entsprechenden Angaben aus anderen<br />
Gegenden Deutschlands (KEßLER 1976, SCHUBERT<br />
1977, NOTHDURFT et al. 1988). Ein besonderes Interesse<br />
galt den Exemplaren von Fichten, die als<br />
»Fraßbäume« bei der Nahrungsaufnahme bevorzugt<br />
wurden. Es zeigte sich, daß solche Bäume<br />
oft den übrigen Bestand überragten, an Rändern,<br />
auf Lichtungen oder ähnlichen Örtlichkeiten<br />
standen. Dadurch erhalten sie mehr Sonne, was<br />
sich wahrscheinlich auf die Menge, den Reifegrad<br />
und die Qualität der Samen günstig auswirkt.<br />
Neben diesen Faktoren spielt vermutlich nicht<br />
selten auch der Zapfentyp eine gewisse Rolle,<br />
da in der Struktur der Zapfenschuppen bei den<br />
verschiedenen Fichtenvarietäten einige Unterschiede<br />
bestehen. Die Bevorzugung bestimmter<br />
Zapfentypen konnte auch BACKHAUS (1961) während<br />
einer Fichtenkreuzschnabel-Invasion in Westfalen<br />
feststellen.<br />
Das ermittelte Geschlechterverhältnis, nach<br />
dem die 0 mit 16,4 % überwiegen, darf wohl als<br />
normal angesehen werden, da es beim Kiefernkreuzschnabel<br />
(MüNcH 1998) wie auch beim<br />
Bindenkreuzschnabel (MüNcH 1980) ähnlich ist.<br />
Im Verhältnis der Rechts- und Linksschläger<br />
hatten die letzteren lediglich einen 0,36 % höheren<br />
Anteil, so daß im allgemeinen wohl eine etwa<br />
gleiche Häufigkeit anzunehmen wäre. Für die