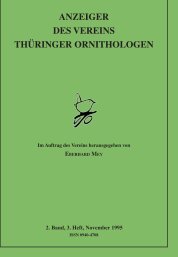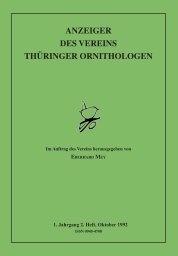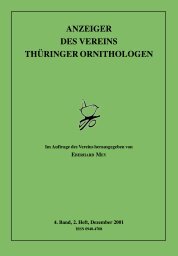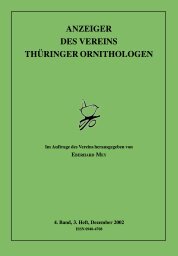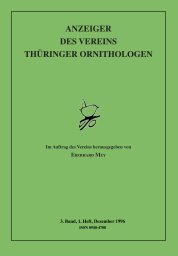anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
96 H. Münch: Zum Vorkommen <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels Loxia c. curvirostra im <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
älteren Periode, die Zeit von 1702 bis 1935 betreffend,<br />
kaum etwas beitragen, denn sie sind meist<br />
sehr allgemein gehalten oder beziehen sich nur<br />
auf einzelne Gebiete und bestimmte Jahre.<br />
Erst die jahrzehntelangen Erhebungen von<br />
1936 bis 1975 erbrachten den Nachweis, daß der<br />
Fichtenkreuzschnabel im Untersuchungsgebiet<br />
in jedem Jahr auftrat, die Zeit und Dauer seines<br />
Vorkommens aber sehr unterschiedlich waren.<br />
Zwar ist er zeitweise nur spärlich und an wenigen<br />
Orten festgestellt worden, ein völliges Fehlen in<br />
einem Zeitraum von einem oder gar mehreren<br />
Jahren - wie bisher allgemein angenommen - gab<br />
es jedoch nicht. In den 40 Jahren der Untersuchungen<br />
im 6212 km2 großen Gebiet betrug die<br />
längste Zeit seines Fehlens nur Imal 7, sonst fünf<br />
oder weniger Monate. Dabei ist zu bedenken, daß<br />
er in einzelnen Monaten, aus denen keine Beobachtungen<br />
vorliegen, nicht unbedingt gefehlt<br />
haben muß.<br />
Andererseits dauerte im Vorland und/oder Gebirge<br />
seine Anwesenheit alljährlich mehrere Monate,<br />
wenn auch mit Unterbrechungen und reichte<br />
öfters bis ins nachfolgende Jahr hinein, so daß<br />
dann Aufenthaltszeiten bis zu 15 Monaten registriert<br />
wurden (Tab. 2). Ein ganzjähriges Vorkommen,<br />
d. h. ständiges Auftreten während eines gesamten<br />
Kalenderjahres konnte keinmal festgestellt<br />
werden. In den Jahren 1964 und 1965 betrug<br />
die Dauer seiner Anwesenheit jeweils maximal 1 1<br />
Monate.<br />
Die besonders lang andauernden Vorkommen<br />
waren meist auf einzelne, bestimmte Waldgebiete<br />
beschränkt und lagen vor allem in den Gebirgsregionen.<br />
Dies erscheint nicht verwunderlich,<br />
denn die dortigen großflächigen Fichtenwälder<br />
mit ihren Zapfenerträgen bildeten dafür den entscheidenden<br />
nahrungsökologischen Faktor. Die<br />
Verteilung der Nachweise auf den Jahresablauf<br />
zeigt, daß er in den Monaten März, Mai, Juni,<br />
Juli, September und Oktober am regelmäßigsten<br />
angetroffen wurde, deren einzelnen Frequenzen<br />
sich aber nur gering unterscheiden (Abb. 2). Erwähnt<br />
sei noch, daß im <strong>Thüringer</strong> Wald auch in<br />
neuerer Zeit in einem etwa 800 ha großen, im<br />
Gebirge gelegenen Forstrevier ein 13 Monate<br />
lang andauern<strong>des</strong> Vorkommen von April 1992 bis<br />
April 1993 beobachtet werden konnte (ROST 1995).<br />
Es dürfte von Interesse sein, die Ergebnisse<br />
der Untersuchungsperiode im <strong>Thüringer</strong> Wald<br />
mit den Verhältnissen in verschiedenen anderen<br />
Gebieten Deutschlands, wo ebenfalls vor Jahrzehnten<br />
Erhebungen zum Vorkommen <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels<br />
durchgeführt wurden, zu vergleichen.<br />
Im Norden ist er im Harz auf einer etwa<br />
850 km2 großen Fläche von 1948 bis 1987 bis auf<br />
eine Ausnahme alljährlich, vor allem in Höhenlagen<br />
von über 500 m Ü. NN und gelegentlich mit<br />
längeren, 7 bis 20 Monaten dauernden Aufenthalt<br />
nachgewiesen worden. Jahreszeitlich war sein<br />
Vorkommen von Mai bis September regelmäßiger<br />
als in den übrigen Monaten (NoTHDURFf et al. 1988).<br />
Im Süden wurden im bayerischen Alpenraum,<br />
dem Werdenfelser Land, auf einem bis zu 1440<br />
km2 großen Gebiet von 1966 bis 1972 regelmäßig<br />
Kontrollen durchgeführt. Dort war der Fichtenkreuzschnabel<br />
vermutlich immer anwesend, wenn<br />
auch in unterschiedlicher Zahl, denn als Zeiten<br />
<strong>des</strong> Fehlens sind lediglich 9mal je ein und 3mal je<br />
zwei Monate festgestellt worden. Im mehrjährigen<br />
Mittel trat er am regelmäßigsten im 2. und 3. Quartal,<br />
teils auch im Oktober auf. Die Aufenthaltsdauer<br />
betrug 1 mal vier, 1 mal 11 und 2m al 13 Monate,<br />
wobei der Schwerpunkt der Verbreitung in<br />
der subalpinen Stufe lag (BEZZEL 1972, BEZZEL &<br />
LECHNER 1978).<br />
Im nordwestdeutschen Flachland wurde im<br />
Bezirk Oldenburg in einem Waldgebiet von 575<br />
ha das Vorkommen <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels<br />
von 1962 bis 1975 registriert. Dabei konnte seine<br />
Anwesenheit fast alljährlich festgestellt werden,<br />
nur im Kalenderjahr 1965 fehlte er vollständig.<br />
Die Aufenthaltsdauer betrug fast immer mehrere<br />
Monate, am längsten 2mal 8, Imal 9 und Imal 16<br />
Monate. Aufgetreten ist er zu allen Jahreszeiten,<br />
deutlich seltener aber von März bis Juni (KEßLER<br />
1976).<br />
Diese Angaben über den Fichtenkreuzschnabel<br />
aus verschiedenen deutschen Gebieten zeigen<br />
im Vergleich mit den Feststellungen im <strong>Thüringer</strong><br />
Wald und seinem Vorland keine wesentlichen<br />
Unterschiede in Bezug auf das jährliche<br />
Vorkommen, die Dauer <strong>des</strong> Aufenthaltes sowie<br />
die Höhenverbreitung im Harz und Alpenraum.<br />
In diesen beiden Gebieten ist auch das jahreszeitliche<br />
Auftreten im allgemeinen ähnlich wie im<br />
<strong>Thüringer</strong> Wald, davon abweichend aber im Bezirk<br />
Oldenburg. Die Ursache für diesen Unterschied<br />
könnten möglicherweise die geographische<br />
Lage, die nahrungs ökologischen und verschiedene<br />
andere Verhältnisse sein.<br />
Von den 47 Brutnachweisen fallen 29 auf Nester,<br />
die mit drei Ausnahmen alle auf Fichten<br />
standen. Die beiden auf Waldkiefern gefundenen<br />
Brutstätten befanden sich in mit Fichten vermischten<br />
Beständen, in denen allerdings die Kiefer<br />
vorherrschte. Die Weißtanne, auf der das Nest<br />
direkt am Stamm gebaut war, stand in einem<br />
größeren Forstbezirk, der zu 75 % mit Fichten<br />
und 25 % Tanne bestockt war.