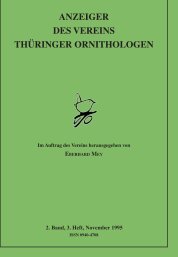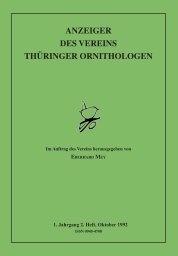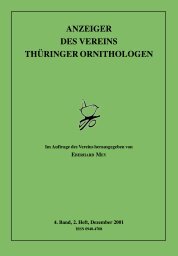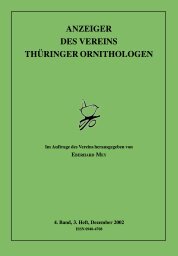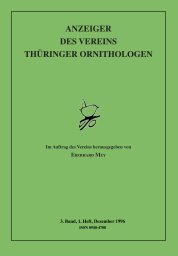anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sind. Um diese Frage exakt zu klären, machte ich<br />
zusammen mit H. Heinz während der Invasion<br />
1962 folgenden Versuch. An einem mit Lockvögeln<br />
versehenen Fangplatz bei Lauscha wurden<br />
an mehreren Tagen im Juni zwei wenige Wochen<br />
alte Jungvögel, einzeln gekäfigt, dazugegeben.<br />
Von den vorüberkommenden Trupps und Scharen<br />
fielen wiederholt Vögel ein, und wenn sich<br />
einer einem Jungvogel näherte, wurde er von<br />
diesem meist lebhaft angebettelt. Wiederholt kam<br />
es dann zum Füttern durch die Gitterstäbe hindurch,<br />
obwohl dies schwierig war und die Futterübergabe<br />
nicht immer erfolgreich verlief. Da es<br />
sich bei den fütternden Vögeln mit Sicherheit<br />
immer wieder um andere Individuen handelte,<br />
konnte das Betreuen fremder Junge eindeutig<br />
nachgewiesen werden.<br />
In den Gebirgsorten, wo die Käfige mit Kreuzschnäbeln<br />
oft außen neben einem Fenster hängen,<br />
werden solche nicht selten von freilebenden<br />
Jungvögeln angeflogen, die dann meist ebenfalls<br />
um Futter betteln. Mitunter kommen auch Vögel<br />
anderer Altersklassen zu den gekäfigten Artgenossen<br />
hin, wozu sie nicht irgendwelche Nahrung,<br />
sondern nur der Geselligkeitstrieb veranlaßt,<br />
wenn auch manchmal zufällig verstreute Samenkörner<br />
aufgelesen werden. Solche Besucher, ob<br />
Jung- oder Altvögel, zeigen meist wenig Scheu,<br />
so daß man sie oftmals mit einem Käscher fangen,<br />
manchmal sogar mit der Hand greifen konnte.<br />
Wie gekäfigte Fichtenkreuzschnäbel auf den<br />
Angriff eines Greifvogels reagieren, konnte ich<br />
einmal am vorerwähnten Fangplatz beobachten.<br />
Ein Sperber Accipiter nisus stieß plötzlich auf<br />
einen Käfig, schlug den darin befindlichen Lockvogel,<br />
zog ihn durch das Drahtgitter hindurch<br />
und verschwand mit der Beute. Die übrigen drei<br />
Lockvögel hatten ungehindert den Vorgang sehen<br />
können, blieben aber wie schockiert in geduckter<br />
Haltung völlig bewegungslos in ihren Käfigen<br />
sitzen und ließen auch keinerlei Laute vernehmen.<br />
Erst einige Minuten nach dem Vorfall begannen<br />
sie allmählich wieder ihre übliche Lebhaftigkeit<br />
zu zeigen.<br />
Lebensraum<br />
Im Untersuchungsgebiet bewohnte der Fichtenkreuzschnabel<br />
vor allem Wälder mit Fichten, sowohl<br />
reine Bestände als auch solche, die mit<br />
Tannen, Kiefern, Lärchen oder Laubgehölzen<br />
gemischt waren. Wichtig war dabei nicht die<br />
Größe der Waldkomplexe, sondern nur das Vorhandensein<br />
von genügend Bäumen mit Zapfen<br />
als Nahrungsgrundlage. Wo dies der Fall war,<br />
Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4 (2000) 91<br />
kam es bisweilen sogar inmitten von Städten<br />
gelegenen koniferenreichen Parks oder Friedhöfen<br />
zu Bruten.<br />
Neben dem Nahrungsangebot spielen bei der<br />
Wahl <strong>des</strong> Brutortes aber noch andere ökologische<br />
Faktoren eine wesentliche Rolle. Geländemäßig<br />
wurden meist freie Lagen wie Hänge,<br />
Bergrücken oder Hochebenen besiedelt, dagegen<br />
tief eingeschnittene, enge Täler kaum einmal.<br />
Sowohl in reinen Fichten- als auch in Mischwäldern<br />
wurden stets ältere Bestände bevorzugt.<br />
Eine Vorliebe bestand für lichte, offene Wälder,<br />
denn in dichten Forsten lagen die Brutplätze immer<br />
nahe an stark gelichteten Stellen wie Schneisen,<br />
Wegen, Wiesen, Kahlschlägen, Windbruchflächen<br />
oder Schonungen. Andererseits diente<br />
gelegentlich auch eine aus Jungwuchs herausragende<br />
oder sonstwie auf freier Fläche exponiert<br />
stehende Baumgruppe als Brutort.<br />
Nahrung<br />
Beobachtungen zur Ernährungsweise <strong>des</strong> Fichtenkreuzschnabels<br />
lassen erkennen, daß von allen<br />
im Untersuchungsgebiet vorkommenden Koniferenarten<br />
die Fichte, insbesondere ihr Zapfen- und<br />
Samenertrag, die Hauptrolle spielt. Dabei war<br />
wiederholt festzustellen, daß in samenreichen<br />
Jahren, wo jeder Baum reichlich Nahrung bot, diese<br />
nur von ganz bestimmten, ausgewählten »Fraßbäumen«<br />
genommen wurde. Unter solchen war<br />
der Boden oft mit Hunderten von abgebissenen,<br />
mehr oder weniger bearbeiteten Zapfen übersät.<br />
Nicht nur bei Samenmangel dienten im Winter<br />
und Frühj ahr fast regelmäßig auch Blatt- und<br />
Blütenknospen der Fichte als Nahrung. Junge Triebe<br />
wurden oft auch abgebissen und nach dem<br />
Befressen falIengelassen. Solche Zweigspitzen<br />
- auch Absprünge genannt - lagen dann in großer<br />
Menge auf dem Waldboden. Dabei war auffallend,<br />
daß nicht wahllos und gleichmäßig alle, sondern<br />
nur ganz bestimmte Bäume befressen wurden,<br />
andere dazwischen völlig verschont blieben. Es war<br />
ähnlich wie bei den vorerwähnten »Fraßbäumen«<br />
im Zusammenhang mit der Samennahrung.<br />
Das Verzehren von Beeren beobachtete W.<br />
SCHMIDT in Igelshieb (Neuhaus a. Rwg.) am 14.<br />
September 1968. Ein Schwarm von etwa 300<br />
Fichtenkreuzschnäbeln ließ sich spätnachmittags<br />
auf den Ebereschen Sorbus aucuparia direkt<br />
neben seinem Haus nieder. Sie zerschroteten die<br />
Beeren und fraßen fast nur die Kerne. Nachdem<br />
fast alle an Bäumen und Büschen hängenden<br />
Früchte verzehrt waren, wurden auch noch die<br />
zu Boden gefallenen aufgenommen. Dies geschah