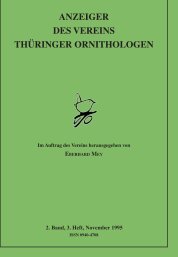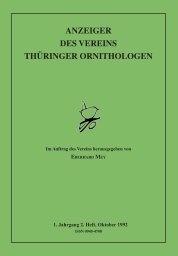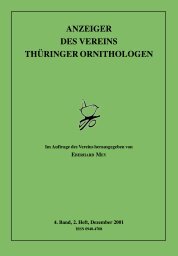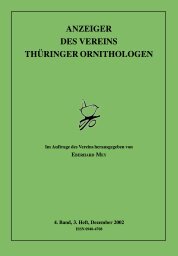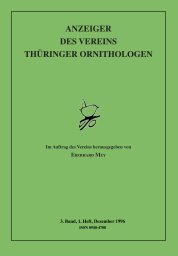anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
64 H. Grimm: Historische und aktuelle Situation der Haubenlerche Galerida cristata in Thüringen<br />
Beckens ist dies durch Tagebuchnotizen von Reinhold<br />
FENK belegt. So z. B. Kornhochheim (1912),<br />
Ingersleben (1912), Gotha (1912), Dachwig (1912),<br />
Fröttstedt (1912, 1916, 1921), Seebergen (1913),<br />
Mühlberg (1913), Griefstedt (1919, 1921, 1924),<br />
Waltershausen (1919), Kloster Donndorf (1915),<br />
zwischen Frankenhausen und Rottleben (1920).<br />
Unter dem 20. 2. 1933 vermerkt er: »Erfurt-Nord:<br />
häufiger Vogel dieser von Schienen durchzogenen<br />
Ortschaften« . Zu jener Zeit war sie auch in<br />
der Nähe der Dörfer <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Beckens nördlich<br />
vom Ettersberg bei Weimar häufiger Brutvogel<br />
(GESSNER 1938 zitiert bei HEYER 1973). Von<br />
Nordthüringen fehlen aus dieser Periode Aufzeichnungen,<br />
jedoch fand sie RINGLEBEN (1934)<br />
in der unmittelbar nördlich angrenzenden Goldenen<br />
Aue »ziemlich häufig an den Stadt- und Dorfrändern«<br />
brüten. Für das erste Drittel <strong>des</strong> 20. Jh.<br />
nennt er sie auch für die Gegend um Mühlhausen<br />
einen häufigen »Brutvogel vor den Städten und<br />
Dörfern« der selbst auf Brachflächen im Hainich<br />
brütete (RINGLEBEN 1931). Im Eichsfeld dagegen<br />
soll sie (wieder?) seltener gewesen sein. Nach<br />
NEUREuTER (1912) trat sie zu jener Zeit selbst im<br />
klimatisch günstigeren Untereichsfeld nur vereinzelt<br />
auf. Weiter schreibt er dazu: »In das Bergland<br />
geht sie nicht hinauf. Auf dem Unter-Eichsfelde<br />
ist sie dagegen häufiger vertreten, geht aber kaum<br />
südlicher als das Leinatal.« In seinen Tagebüchern<br />
werden als Brutplätze Niederorschel, Küllstedt,<br />
Rohrberg, Westhausen und Heiligenstadt<br />
genannt (WODNER 1975). Zu Beginn <strong>des</strong> 20. Jh.<br />
brütete sie auch in Eisenach. Nach BÜSING (1914)<br />
nistete dort »z. B. auf dem Dach <strong>des</strong> hiesigen<br />
Diakonissenhauses seit mehreren Jahren ein Haubenlerchenpaar.«<br />
Von Dachbruten aus dieser Zeitspanne<br />
(1912) wird auch von Altenburg berichtet<br />
(HILDEBRAND & SEMMLER 1975).<br />
In der Umgebung von Greiz war die Haubenlerche<br />
zu Beginn <strong>des</strong> 20. Jh. ein »bekannter und<br />
regelmäßiger Brutvogel ... an Bahnböschungen,<br />
auf Bahnhöfen ... , Brachländereien ... und anderen,<br />
nicht in Waldnähe liegenden Plätzen« (HELLER<br />
1926). HIRSCHFELD (1932) berichtet aus der Gegend<br />
von Hohenleuben, daß sie dort »häufig anzutreffen«<br />
war. Er fand u. a. ein Nest unter einer Eisenbahnschiene.<br />
Nach SCHMlEDEKNECHT (1927) war sie<br />
insgesamt »in Thüringen jetzt an vielen Orten, wo<br />
sie früher nicht war, z. B. Rudolstadt, Blankenburg«<br />
(s. Nachtrag p. 76). Nun tauchen auch vermehrt Hinweise<br />
aus dem südthüringischen Gebirgsvorland<br />
und dem <strong>Thüringer</strong> Wald auf. SUNKEL (1926) vermerkt,<br />
daß die Rhön zu Beginn <strong>des</strong> 20. Jh. »nur<br />
an wenigen Stellen Haubenlerchen« hat. Er traf<br />
sie »an den Rändern <strong>des</strong> Gebirges und in den<br />
Tälern meist auf thüringischem Gebiet.« Am 23.<br />
Juli 1936 sah er sie bei Breitungen (SUNKEL 1953).<br />
Am gleichen Ort bemerkte sie FENK schon im Juni<br />
1921 (FENK, Tagebuch). Im Grabfeld soll sie in<br />
der ersten Hälfte <strong>des</strong> 20. Jh. »nicht selten an<br />
Bahnhöfen und Schuttplätzen« gebrütet haben<br />
(GUNDELwEIN 1953). WEIß (1908) nennt Brutplätze<br />
im Grabfeld aus Römhild und Heldburg, im Werratal<br />
aus Frauenbreitungen, Wasungen und (Bad)<br />
Salzungen. Desweiteren gibt er sie für die Meininger<br />
Kalkplattenlandschaft von Untermaßfeld,<br />
Themar und Hildburghausen an; aus dem Schalkauer<br />
<strong>Thüringer</strong> Wald-Vorland von Schwarzenbrunn<br />
und Effelder. Im nur 15 km von der heutigen<br />
Lan<strong>des</strong>grenze südlich gelegenen unterfränkischen<br />
Bad Neustadt hat sie min<strong>des</strong>tens seit 1909,<br />
vermutlich aber schon früher in wenigen Paaren<br />
gebrütet (WÜST 1986).<br />
Aus dieser Zeit <strong>des</strong> Bestandshochs stammen<br />
auch vermehrt Beobachtungen aus dem <strong>Thüringer</strong><br />
Gebirge. WEIß (1908) nennt Brutzeitbeobachtungen<br />
aus dem Hohen Thüringischen Schiefergebirge<br />
von den Orten Heubach und Steinheid,<br />
während sie nach seinen Angaben in Unterneubrunn<br />
nur im Winter erschien. Ob die andernorts<br />
(z. B. RINGLEBEN 1970) erhobenen Zweifel an der<br />
Zuverlässigkeit der WEIßschen Angaben auch<br />
für die kaum mit einer anderen Art zu verwechselnde<br />
Haubenlerche berechtigt sind, kann hier<br />
nicht geklärt werden. Zumin<strong>des</strong>t gelten sie nicht<br />
in pauschaler Form und nicht alle Beobachter<br />
betreffend, worauf eingeschränkt bereits RING<br />
LEBEN selbst, ausdrücklich aber MEY (1997) hinwies.<br />
Auch WICHTRICH (1937) zählt die Haubenlerche<br />
zu den Brutvögeln <strong>des</strong> »höchsten Thüringens«<br />
. Er erwähnt, daß der »Kosakenvogel«<br />
überall gehört wurde und bis in eine Höhe von<br />
750 m ü. NN brütend vorkam. Für Dörrberg gibt<br />
er sie als Brutvogel an, wogegen sie in Finsterbergen<br />
nur im Winter vorgekommen sein soll. Die<br />
wenigen Ansiedlungen im höheren <strong>Thüringer</strong><br />
Wald waren aber offenbar nur von kurzer Dauer.<br />
Für die Gegend um Schmiedefeld führt sie GERBER<br />
(1934), unter Berufung auf den ortsansässigen<br />
G. EHRHARDT, nur als Durchzügler auf.<br />
Insgesamt scheint in dieser Zeitspanne auch<br />
in Thüringen der Höhepunkt der Bestandsentwicklung<br />
erreicht und lokal z. T. bereits überschritten<br />
gewesen zu sein. Für Greiz datieren<br />
LANGE & LEO (1978) das Verschwinden der Art<br />
schon in das erste Drittel <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts.<br />
Auch für das Eichsfeld vermutet WODNER (1975),<br />
daß die Haubenlerche bereits zu Beginn <strong>des</strong> Jahrhunderts<br />
»gewaltig an Siedlungsraum und Zahl<br />
eingebüßt« hat.