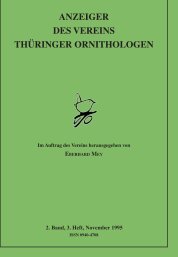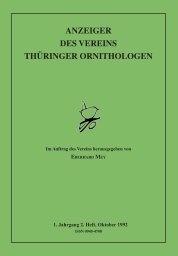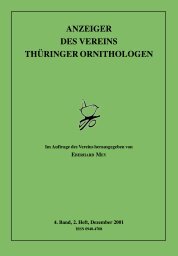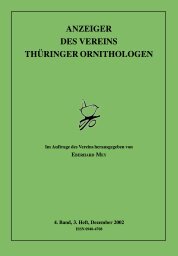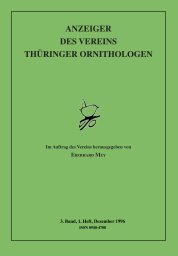anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hört.» Bereits kurz nach der Jahrhundertmitte<br />
(oder bereits vorher?) soll sie schon auf den kahlen<br />
Hochflächen der Ilmplatte bei Stadtilm genistet<br />
haben (SIGISMUND 1858; zitiert bei MEY 1992).<br />
Drei Jahrzehnte später gibt es auch den ersten<br />
Hinweis für das Brüten auf dem Eichsfelde. Nach<br />
STRECKER (1879) trat sie »vor 30 und mehr Jahren«<br />
- also zur Mitte <strong>des</strong> 19. Jh. - nur im Winter auf ;<br />
»jetzt ist sie Standvogel und nistet hier. Sie ist fast<br />
so häufig wie die Feldlerche.« Auf die STRECKER<br />
SCHE Aussage stützt sich wohl auch BRINKMANN<br />
(1933), wenn er angibt: »Auf dem Eichsfelde trafen<br />
die ersten Haubenlerchen 1849 ein, 1879 waren<br />
sie häufig«. Im Verzeichnis <strong>des</strong> Freiherrn v. MIN<br />
NIGERODE wird das Jahr 1860 genannt, in dem die<br />
Haubenlerche erstmals im nördlichen Eichsfeld<br />
bei Bockeinhagen auftrat (BLATH 1900). Diesen<br />
Zeitpunkt hält BORcHERT (1927) für eigenartig<br />
spät. Für das an Nordwestthüringen grenzende<br />
hessischen Witzenhausen verweist SUNKEL (1926)<br />
auf eine Notiz <strong>des</strong> Grafen VON BERLEPSCH, der die<br />
Art dort zu jener Zeit (1880) einen »unbedingten<br />
Sommervogel« genannt haben soll. In der zitierten<br />
Quelle, die gleichlautend noch einmal bei<br />
GEBHARDT & SUNKEL (1954) erwähnt wird, fehlt<br />
allerdings die BERLEPSCHSche Aussage zu Witzenhausen.<br />
Aus den vom Oberförster v. VULTEJUS<br />
dem Ausschuß für Beobachtungsstationen der<br />
Vögel zwischen 1877 und 1884 gemeldeten Beobachtungen<br />
geht hervor, daß die Haubenlerche<br />
auch in Walkenried, 15 km NW von Nordhausen,<br />
min<strong>des</strong>tens seit 1878 gebrütet hat: »In Walkenried<br />
wurden die Haubenlerchen während <strong>des</strong> ganzen<br />
Sommers vom 8. März bis zum 27. October ...<br />
beobachtet. Bruten wurden notirt in ... Walkenried<br />
Mai und Juli ... « (Anonymus 1880). Aus dem<br />
nordthüringischen Sondershausen wird sie für<br />
1876 noch als Strichvogel angeführt, der im Winter<br />
in die Straßen der Ortschaften kommt (BAU et.<br />
al. 1877), bereits aber für 1885 und 1886 als häufiger<br />
Standvogel (Anonymus 1887, 1888).<br />
In diesem Zeitraum hatte die Haubenlerche auch<br />
den Frankenwald in Höhen um 540 m besiedelt.<br />
LIEBE (1878) nennt Ebersdorf und Lobenstein, wo<br />
sie zur Brutzeit angetroffen wurde. Hier ist eine<br />
Einwanderung über das Saaletal denkbar. Weiter<br />
südlich, im benachbarten oberfränkischen Hof,<br />
gab es sie zu dieser Zeit nur im Winter. Dagegen<br />
war sie 50 km weiter, in dem am Südrand der Mitteldeutschen<br />
Gebirgsschwelle gelegenen Bayreuth<br />
»schon sehr häufig und nach dem Sperling<br />
der gemeinste Vogel« (GUBITZ & PFEIFER 1993). In<br />
den bei den letzten Dezennien <strong>des</strong> 19. Jh. tauchen<br />
bereits Hinweise zur Brutzeit aus dem <strong>Thüringer</strong><br />
Wald auf. Für 1884 wird sie aus mehreren Orten<br />
Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4 (2000) 63<br />
an <strong>des</strong>sen Nordrand (Dörrberg, Finsterbergen,<br />
Tabarz) nur als Wintergast aufgeführt. Nach Angaben<br />
von Revierförster PRESSLER soll sie in Katzhütte<br />
aber schon 1885 Brutvogel gewesen sein,<br />
der Mitte Oktober wieder abzog, bereits ein Jahr<br />
früher wird sie von Hohleborn bei Seligenthai als<br />
Standvogel gemeldet (Anonymus 1886,1 887).<br />
Zumin<strong>des</strong>t für Katzhütte, das in einem tief eingekerbten,<br />
bewaldeten Tal liegt, erscheinen Zweifel<br />
an der Richtigkeit dieser Beobachtung gerechtfertigt.<br />
Allerdings muß an dieser Stelle auch<br />
darauf verwiesen werden, daß sich das damalige<br />
Landschaftsbild <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong> Wal<strong>des</strong> deutlich<br />
von dem heutigen unterschied. Bis in die 50er<br />
Jahre <strong>des</strong> 20. Jh. wurde Ackerbau, besonders im<br />
Umfeld der Dörfer, bis in die höchsten Lagen betrieben<br />
und der Anteil ackerbaulich genutzter<br />
Flächen konnte bis 50% <strong>des</strong> Offenlan<strong>des</strong> einnehmen.<br />
Dabei waren die Felder und Wiesen durch<br />
den fortwährenden Nährstoffentzug außerordentlich<br />
karge Standorte (z. B. BRETTFELD & BOCK<br />
1994). Auch von Südthüringen gibt es in den<br />
beiden letzten Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende<br />
erste Beobachtungen zur Brutzeit. Während<br />
noch RUMER (1880) für das Werratal ausdrücklich<br />
betont: »Alauda cristata bemerkte ich<br />
nicht« , wird sie 1885 von Erbenhausen IRhön als<br />
Standvogel gemeldet (Anonymus 1887). Auch im<br />
nur 5 km von der thüringischen Lan<strong>des</strong>grenze<br />
entfernten unterfränkischen Mellrichstadt hat sie<br />
1895 bereits in wenigen Paaren gebrütet (WÜST<br />
1986). Für das oberfränkische Coburg, das bis<br />
1920 zum thüringischen Herzogtum Sachsen<br />
Coburg-Gotha gehörte, erwähnt BRücKNER (1926),<br />
daß sie dort seit den 70er Jahren »im Winter auch<br />
in das Stadtgebiet« kam. Doch muß sie schon zu<br />
BRÜCKNERS Zeiten und früher dort gebrütet haben,<br />
denn schon 1885 wird die Haubenlerche für das<br />
direkt an Coburg angrenzende Weidach als Standvogel<br />
bezeichnet, der sich dort seit Jahren stark<br />
vermehrt habe (Anonymus 1887).<br />
4.3. Beginn <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts bis 1940<br />
Die Art war in diesem Zeitraum in den tieferen<br />
Lagen vielerorts inzwischen so häufig geworden,<br />
daß sie kaum noch besondere Beachtung fand<br />
und die Angaben dazu weitgehend allgemeiner<br />
Natur sind.<br />
In Erfurt war sie »häufiger Jahresvogel, der im<br />
Winter auch die Straßen der Stadt belebt« (TIMPEL<br />
1935) und bewohnte auch, wie die Feldlerche,<br />
»zahlreich die weiten Fluren der Ebenen« (TIMPEL<br />
1912). Von verschiedenen Orten <strong>des</strong> <strong>Thüringer</strong>