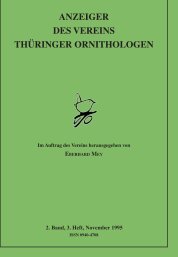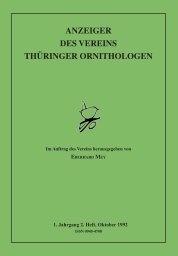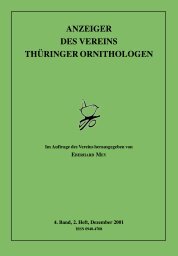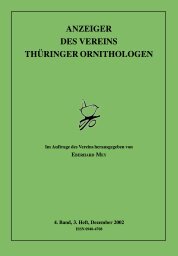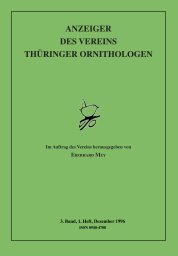anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
anzeiger des vereins thüringer ornithologen - Verein Thüringer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Daß auch der Bodentyp die Verbreitung der<br />
Haubenlerche beeinflußt, wird mehrfach in der<br />
Literatur erwähnt. So besitzt z. B. die Art im benachbarten<br />
Sachsen-Anhalt ein geschlossenes<br />
Verbreitungs gebiet in den Sandgebieten im Nordosten<br />
(GNIELKA & ZAUMSEIL 1997). Ähnliches wird<br />
von Hessen berichtet (BERcK & LUCAN 1993). Derartige<br />
Böden fehlen in Thüringen. Die Vermutung<br />
MANSFELDS (1963), daß der Haubenlerche der<br />
schwere Boden der Umgebung von Seebach (wie<br />
auch andernorts im <strong>Thüringer</strong> Becken) offenbar<br />
nicht zusagt, trifft unter der gegenwärtigen Nährstoffsituation<br />
wohl zu. Das war aber wahrscheinlich<br />
nicht immer so und dieser vom Optimum abweichende<br />
Faktor konnte durch entsprechenden<br />
Bewirtschaftung in Grenzen kompensiert werden.<br />
In einer interessanten Studie hat SCHERNER (1996)<br />
den Einfluß der Bewirtschaftung auf die Verbreitung<br />
und den Bruterfolg der Haubenlerche dargelegt.<br />
Die hohen Nährstoffgaben und die zusätzlich<br />
hohe Stickstoffdeposition aus der Luft,<br />
welche allein die Werte <strong>des</strong> in der Landwirtschaft<br />
zur Jahrhundertmitte eingesetzten weit übersteigt,<br />
führen zum raschen Aufwachsen der Bestände<br />
und zu massiver Veränderung der mikroklimatischen<br />
Verhältnisse; hin zu kühleren und feuchteren<br />
Bedingungen. Dies trifft nicht nur die Haubenlerche<br />
und ist als Ursache für Bestandseinbußen<br />
bereits für viele andere Arten beschrieben<br />
worden. Das dies isoliert nicht als einzige Ursache<br />
angesehen werden kann, zeigen uns die<br />
Bestandseinbrüche in den 40er und 50er Jahren.<br />
Zu jener Zeit erreichte der Stickstoffeinsatz in<br />
der Landwirtschaft einen Tiefpunkt (1946/47 nur<br />
etwa 1/1 0 <strong>des</strong> Wertes von 1970/7 1 - HENNING<br />
1988), und die Nutzung der Biomasse auf allen<br />
Flächen war in der Nachkriegszeit weit höher als<br />
heute. Wahrscheinlich ist es immer ein Ursachenkomplex,<br />
bei dem einzelne Faktoren, gegenseitig<br />
beeinflußt, mehr oder weniger stark wirksam<br />
werden. Trotz dieser Einschränkung muß unter<br />
den heutigen klimatischen- und Nutzungsverhältnissen<br />
die Eutrophierung der Landschaft als<br />
das Hauptproblem für die Haubenlerche angesehen<br />
werden. Für ihren Rückgang in Thüringen<br />
läßt sich folgende Kausalbeziehung aufzeigen,<br />
die im wesentlichen auch für andere Landschaften<br />
gilt. Dabei wirken die verschiedenen Faktoren<br />
lokal unterschiedlich stark: Mit zunehmender<br />
Intensivierung der Landwirtschaft (besonders N<br />
Düngung) verschwanden karge oder längere Zeit<br />
offen gehaltene Flächen. Potentielle Habitate wurden<br />
somit auf wenige anthropogen geprägte Sekundärbiotope<br />
im Siedlungs- und Siedlungsrandbereich<br />
reduziert. Folge war nicht nur eine<br />
Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4 (2000) 73<br />
drastische Verkleinerung der Siedlungsfläche,<br />
sondern vor allem eine starke Verinselung der<br />
Population. Eine solche Habitatfragmentation hat<br />
vor allem bei Arten mit geringem Aktionsradius<br />
- wie bei der Haubenlerche - die ganzjährig ortsgebundene<br />
Ressourcen beanspruchen, verheerende<br />
Wirkung (BEzzEL 1995). Darüber hinaus<br />
weisen die besiedelten Sekundärbiotope mehrere<br />
Merkmale auf, die einer langfristigen relativen<br />
Stabilität der Bestände entgegenwirken: Es sind<br />
Flächen im Initialstadium, die nach kurzer Zeit<br />
sowohl anthropogen verändert werden, als auch<br />
- durch hohen Nährstoffeintrag - rasch der Sukzession<br />
unterliegen. Die Dichte der Prädatoren<br />
in diesen Lebensräumen ist in den letzten Jahren<br />
deutlich angestiegen. Der hohe Grad an Synanthropie,<br />
den die Haubenlerche bereits seit Jahrhunderten<br />
auszeichnet, wird heute auch von<br />
einigen ihrer Prädatoren (z. B. Fuchs, Steinmarder,<br />
Elster, Rabenkrähe, auch Turmfalke Falco tinnunculus)<br />
ebenso erreicht. Dadurch sinkt die Zahl<br />
der Nachkommen und die Wahrscheinlichkeit<br />
von Neuansiedlungen. Infolge der Verinselung<br />
<strong>des</strong> stark geschrumpften Bestan<strong>des</strong> wird schnell<br />
und oft, bereits durch Einzelereignisse hervorgerufen,<br />
die Größe überlebensfähiger Populationen<br />
unterschritten.<br />
Literatur<br />
ABs, M. (1963): Vergleichende Untersuchungen an<br />
Haubenlerche (Galerida cristata (L.» und Theklalerche<br />
(Galerida theklae A. E. Brehm). - Bonn. zool.<br />
Beitr. 14, 1-128.<br />
Anonymus (1878): n. Jahresbericht (1877) <strong>des</strong> Ausschusses<br />
für Beobachtunsstationen der Vögel Deutschlands.<br />
- J. Ornithol. 26, 370-436.<br />
- (1880): III. Jahresbericht <strong>des</strong> Ausschusses für Beobachtungsstationen<br />
der Vögel Deutschlands. - J. Ornithol.<br />
28, 12-96.<br />
- (1886): IX. Jahresbericht (1884) <strong>des</strong> Ausschusses für<br />
Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. - 1.<br />
Ornithol. 34, 129-388.<br />
- (1887): X. Jahresbericht (1885) <strong>des</strong> Ausschusses für<br />
Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. - J.<br />
Ornithol. 35, 33-615.<br />
- (1888): XI. Jahresbericht (1886) <strong>des</strong> Ausschusses für<br />
Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. - J.<br />
Ornithol. 26, 313-571.<br />
BARNIKOW, G., E. SCHÜTZ & W. STÖßEL (1971): Ornithologische<br />
Notizen aus Auma und Umgebung. - Jahrb.<br />
Museum Hohenleuben-Reichenfels 19, 73-90.<br />
BAU, A., R. BLASIUS, A. REICHENOW & H. SCHALOW (1877):<br />
Zur Vogelkunde Deutschlands. l. Jahresbericht (1876)<br />
<strong>des</strong> Ausschusses für Beobachtunsstationen der Vögel<br />
Deutschlands. - J. Ornithol. 25, 278-342.