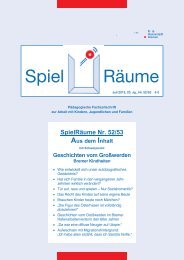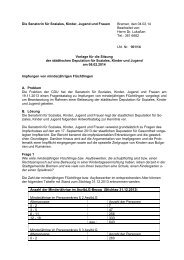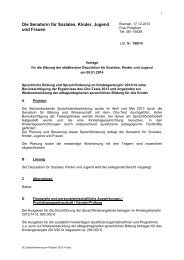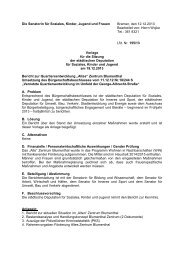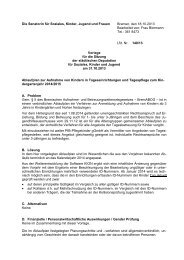ANK_Jugendliche_Schule_Beruf2008.18878.pdf - Die Senatorin für ...
ANK_Jugendliche_Schule_Beruf2008.18878.pdf - Die Senatorin für ...
ANK_Jugendliche_Schule_Beruf2008.18878.pdf - Die Senatorin für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
38<br />
Ausbildung<br />
2.6 <strong>Die</strong> Hartz-Reform und der<br />
Umgang mit Jugendarbeitslosigkeit<br />
Mit den Hartz-Gesetzen haben sich die Ziele<br />
der bundesdeutschen Arbeitsmarkt- und<br />
Berufsbildungspolitik grundsätzlich verändert.<br />
Das zeigen schon die Begrifflichkeiten, wenn<br />
statt wie zuvor von einer ›aktiven‹ nun von der<br />
›aktivierenden‹ Arbeitsmarktpolitik die Rede<br />
ist. Hier hat der Akteur klar vom handelnden<br />
Staat zum behandelten Individuum gewechselt.<br />
Welche Folgen hat dieser Wandel speziell<br />
<strong>für</strong> <strong>Jugendliche</strong> und Erwachsene?<br />
<strong>Die</strong> aktivierende Arbeitsmarktpolitik lässt<br />
sich in drei zentrale Zieldimensionen unterteilen:<br />
36<br />
›Verfügbarkeit‹, das heißt Arbeitsbereitschaft.<br />
Sie soll entweder über fordernde<br />
oder sanktionierende Instrumente hergestellt<br />
werden oder aber über fördernde<br />
Elemente, sofern eine individuelle Arbeitsbereitschaft<br />
unterstellt wird, aber durch<br />
spezielle Hemmnisse eingeschränkt wird.<br />
›Eigenverantwortung‹, das heißt das Prinzip<br />
der Selbstvermarktung der (arbeitslosen)<br />
Arbeitskraft. Auch hier sind fordernde,<br />
sanktionierende sowie fördernde Elemente<br />
im Falle individueller Defizite und Barrieren<br />
vorgesehen.<br />
›Beschäftigungsfähigkeit‹, das heißt das<br />
permanent anzupassende individuelle Vermögen,<br />
den sich wandelnden Anforderungen<br />
des Arbeitsmarktes nachzukommen.<br />
An den Zieldimensionen der aktivierenden<br />
Arbeitsmarktpolitik lassen sich die zentralen<br />
Unterschiede zur ›alten‹ aktiven Arbeitsmarktpolitik,<br />
wie sie <strong>für</strong> den klassischen Sozialstaat<br />
charakteristisch war, identifizieren. <strong>Die</strong> aktive<br />
Arbeitsmarktpolitik beruhte auf dem Grundwert<br />
der Solidarität mit den Zielen Chancengleichheit<br />
und Durchsetzung eines ›Rechts auf<br />
Arbeit‹. Dagegen fokussiert die aktivierende<br />
Arbeitsmarktpolitik die Verwirklichung der<br />
unterschiedlichen individuellen Chancen. Sie<br />
wandelt damit das ›Recht auf Arbeit‹ um in<br />
ein ›Recht auf Hilfe zur Arbeit‹. Im Falle einer<br />
unterstellten fehlenden Mitwirkung der Adressaten<br />
entwickelt sich aus dem ›Recht auf<br />
Hilfe zur Arbeit‹ die ›Pflicht zur Aktivierung‹. 37<br />
Das freilich unterstellt und behauptet, es stünden<br />
jederzeit Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote<br />
zur Verfügung. Dass dies nicht der<br />
Fall ist, hat der vorangegangene Abschnitt<br />
gezeigt. <strong>Die</strong> Wirkung von Arbeitsmarktpolitik<br />
ändert sich mit dieser neuen Setzung fundamental:<br />
Während die aktive zu einem Ausgleich<br />
von Angebot und Nachfrage auf dem<br />
Arbeitsmarkt beitragen will, zielt die aktivierende<br />
Arbeitsmarktpolitik auf eine Verhaltensänderung<br />
der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchenden<br />
ab. 38 Dass sich daraus auch<br />
Konsequenzen <strong>für</strong> die Bereitstellung arbeitsmarktbezogener<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen ergeben,<br />
versteht sich damit von selbst. 39<br />
Auch der Übergang von der <strong>Schule</strong> ins<br />
Arbeitsleben ist von der arbeitsmarktpolitischen<br />
Reform betroffen. <strong>Die</strong> Altersgruppe der<br />
15- bis 25-Jährigen ist eine der Zielgruppen<br />
der neuen Politik. Laut Gesetz müssen sie<br />
unverzüglich nach Antragstellung in Arbeit,<br />
Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit (Ein-<br />
Euro-Job) vermittelt werden. Findet sich keine<br />
Ausbildung, so sollen die vermittelte Arbeit<br />
oder die Arbeitsgelegenheit zur Verbesserung<br />
der beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten<br />
beitragen (§ 3 SGB II). Der Leistungsträger<br />
(BAgIS/Bremer Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Integration<br />
und Soziales beziehungsweise ARGE<br />
Job-Center Bremerhaven) sieht sich also nicht<br />
verpflichtet, eine Ausbildungsförderung zu<br />
betreiben oder eine solche aus eigenen Mitteln<br />
zu finanzieren. Der bisher gültige gesellschaftliche<br />
Konsens einer ›Ausbildung <strong>für</strong> alle‹<br />
ist also in der Praxis aufgehoben.<br />
36 Vgl. Marquardsen, Kai (2007): Was ist ›Aktivierung‹ in der<br />
Arbeitsmarktpolitik?; in: WSI-Mitteilungen 5/2007, S. 259–265.<br />
37 Vgl. Knuth, Matthias/Schweer, Oliver/Siemes, Sabine (2006):<br />
Drei Menüs und kein Rezept? <strong>Die</strong>nstleistungen am Arbeitsmarkt<br />
in Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark, S. 489;<br />
in: Siller, Peter/Dückert, Thea/Baumann, Arne (Hrsg.): Arbeit<br />
der Zukunft. Neue Wege einer gerechten und emanzipativen<br />
Arbeitspolitik, S. 419–509.<br />
38 Ausführlich dazu der Beitrag von Michael Galuske in diesem<br />
Bericht.<br />
39 Vgl. Bartelheimer, Peter (2005): Moderne <strong>Die</strong>nstleistungen und<br />
Erwerbs<strong>für</strong>sorge, Fallbearbeitung nach SGB II als Gegenstand<br />
soziologischer Forschung; in: SOFI-Mitteilungen 33/2005,<br />
S. 55–79.