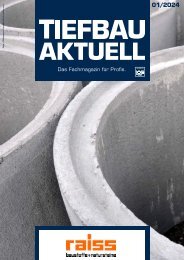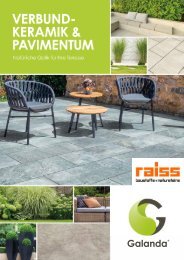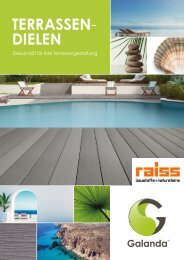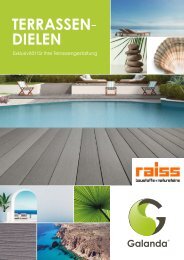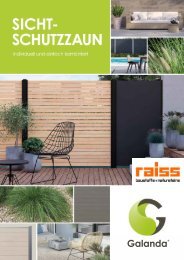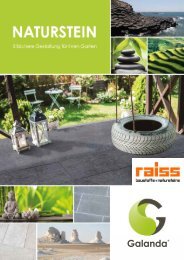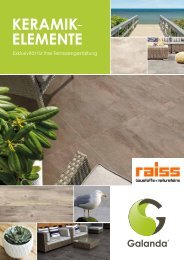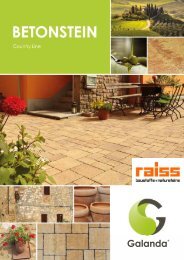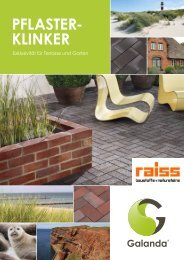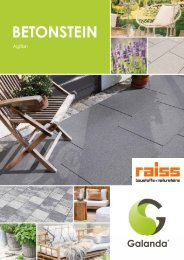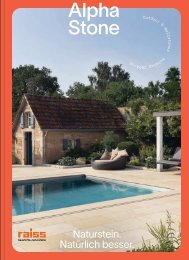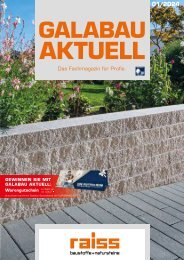Profiwissen Fassade - Raiss
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5. Wärmeschutz<br />
Im „ProfiWissen Holzbau“ [25] werden einige grundsätzliche Informationen<br />
zum Wärmeschutz gegeben. Die <strong>Fassade</strong>nkonstruktion kann unterschiedlich<br />
in den wärmeschützenden Aufbau der Außenwand<br />
einbezogen werden. Die Hauptdämmebene kann in der tragenden Rohbaukonstruktion<br />
integriert werden (Beispiel: Holzrahmenbau) oder auch<br />
von außen in den Unterbau der <strong>Fassade</strong> integriert werden (Beispiele:<br />
WDVS oder VHF im Altbau).<br />
Bei den heutigen Wärmeschutzanforderungen wird im Neubau in den<br />
meisten Fällen eine Kombination gewählt. Die Rohbau- und <strong>Fassade</strong>nkonstruktion<br />
werden wärmeschutztechnisch optimiert.<br />
Die konstruktiven Grenzen bezüglich des Wärmeschutzes werden in<br />
„Unterkonstruktion“ auf Seite 111 dargestellt.<br />
U-Wert Tabellen sind zu finden:<br />
• Tab. A11.1, Seite 9 – Neubau mit versch. Holzfaserdämmplatten<br />
• Tab. B0.4, Seite 57 – Altbau mit VHF<br />
• Tab. B0.5, Seite 57 – Altbau mit WDVS<br />
• Tab. B13.1, Seite 77 – Fertighaussanierung mit VHF<br />
• Tab. B14.1, Seite 81 – Fertighaussanierung mit WDVS<br />
Winddichtheit<br />
In DIN 4108-7 1 wird der Begriff „Winddichtheit“ zumindest in Abgrenzung<br />
zum Begriff „Luftdichtigkeit“ definiert, jedoch hierfür keine technischen<br />
Anforderungen gestellt. Die Winddichtheit gewährleistet, dass eine<br />
Wand- / <strong>Fassade</strong>nkonstruktion oder eine außenseitige Wärmedämmung<br />
nicht mit Außenluft durchströmt bzw. hinterströmt wird. Betroffen sind<br />
insbesondere leichte Faserdämmstoffe.<br />
Die Winddichtheitsschicht wird bei einer hinterlüfteten <strong>Fassade</strong> z. B. von<br />
einer <strong>Fassade</strong>nbahn oder von einer Unterdeckung an der Außenseite<br />
der Wärmedämmung gebildet. Die winddichte Schicht deckt durchlässige<br />
Faserdämmstoffe ab.<br />
<br />
Bei fehlender Winddichtung ist die geringere Dämmwirkung als<br />
Abschlag auf die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffes zu<br />
berücksichtigen. Eine technische Regel gibt es dazu allerdings<br />
nicht.<br />
1 Titel: „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden“<br />
Teil 7: „Luftdichtheit von Gebäuden - Anforderungen, Planungs- und<br />
Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele“.<br />
6. sommerlicher Hitzeschutz<br />
Der sommerliche Hitzeschutz scheint ein Qualitätsmerkmal, dass dem<br />
winterlichen Wärmeschutz nachsteht. Jedenfalls wird in Beratungsgesprächen<br />
umfassend über den Wärmeschutz gesprochen und dagegen<br />
über den sommerlichen Hitzeschutz nur wenig.<br />
Viele Bauherren wollen bei ihren Neubauten oder auch bei Sanierungsmaßnahmen<br />
möglichst helle Räume und viel Tageslicht. Das ist nachvollziehbar<br />
und gegen üppige Glasflächen ist nichts einzuwenden. Allerdings<br />
ist das Überhitzen der Räume zu verhindern. Die Energieeinsparverordnung<br />
(EnEV) sieht dazu einen Nachweis vor, um den Einsatz von<br />
Kühlenergie zu begrenzen bzw. im Idealfall Klimaanlagen zu vermeiden.<br />
1. Sonnenschutzvorrichtungen für die transluzenten Flächen<br />
(Verglasungen).<br />
2. Optimierung der Baukonstruktion - hier ist allerdings das Dach von<br />
größerer Bedeutung gegenüber der Außenwand. Hinterlüftungen<br />
von <strong>Fassade</strong>nbekleidungen sind sehr wirkungsvoll.<br />
3. Luftdichtheit der Gebäudehülle, um einen Luftaustausch bei großer<br />
Sommerhitze zu reduzieren<br />
Die Überhitzung der Wohn- und Schlaf- und Arbeitsräume wird als sehr<br />
unangenehm wahr genommen. Wie warm darf es in den Räumen werden?<br />
Es gibt zwar keine „zulässige“ Obergrenze für die Raumtemperatur.<br />
Wohl aber gibt es Zielwerte. Diese sind für die Regionen in<br />
Deutschland unterschiedlich 2 :<br />
• 25°C in Region A (sommerkühl)<br />
• 26°C in Region B (gemäßigt)<br />
• 27°C in Region C (sommerheiß)<br />
Um dieses Ziel zu erreichen, sollten planerisch drei Bedingungen erfüllt<br />
werden. Die folgende Liste ist nach ihrer Bedeutung für den sommerlichen<br />
Hitzeschutz sortiert.<br />
Bild: MOCOPINUS<br />
Abb. C11.21 Bei den Maßnahmen zum sommerlichen Hitzeschutz<br />
stehen die Verschattungen von Glasflächen an erster Stelle.<br />
2 Eine Kartierung enthält die DIN 4108-2.<br />
95