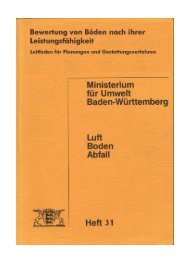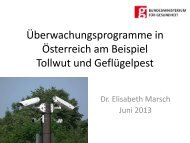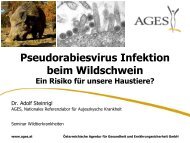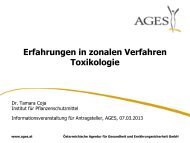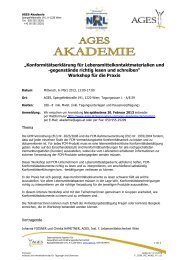Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
Linie die Entfernung der unerwünschten (GVO) Pollenspender-Flächen zu den (Nicht-GVO-)Pollenempfänger-<br />
Flächen.<br />
Im Vorläuferprojekt wies die Messmethode, die die Entfernung vom nächstliegenden Feldrand der Pollenspender-<br />
Fläche zum Feldmittelpunkt der Pollenempfänger-Fläche bestimmte, die höchste Korrelation auf (siehe GIRSCH et<br />
al., 2006). Auch in der vorliegenden Studie hat sich als bestes Modell die Entfernung als Distanz vom nächsten<br />
Rand des Pollenspenderfeldes zum Zentroid des Empfängerfeldes definiert (Rand/Mitte – siehe Modellvariante<br />
3b).<br />
Ähnliche Versuchsanstellungen wurden von ŠUŠTAR-VOZLIČ (2008) in Slowenien untersucht: zur Erstellung eines<br />
Prognosemodells wurden u.a. folgende Parameter berechnet: Minimumdistanz, definiert als kürzeste Entfernung<br />
vom Probenahmepunkt zum Rand des Spenderfeldes, Zentroiddistanz, entspricht der kürzesten Entfernung vom<br />
Probenahmepunkt zur Mitte des Spenderfeldes, Visueller Winkel = der Winkel zwischen Eckpunkten des<br />
Spenderfeldes und dem Probenahmepunkt (0-180°), sowie meteorologische Parameter wie z.B Windtunnellänge ,<br />
die sich aus der Hauptwindrichtung ergibt. Bei diesem Versuch wurde die Auskreuzungsrate am stärksten durch<br />
die Minimumdistanz beeinflusst, Windrichtung und –geschwindigkeit zeigten keinen signifikanten Effekt. Mehr als<br />
80 % der Variation war erklärbar durch Entfernung und Position des Probenahmepunktes.<br />
8.2. Umweltbedingte Einflussfaktoren<br />
8.2.1. Pollenflug<br />
Besonders im Zusammenhang mit der Fragestellung der Auswirkungen von GVO auf Nichtzielorganismen werden<br />
laufend Studien durchgeführt, bei denen man mittels technischer Pollensammler quantitativ die Pollendeposition,<br />
den Pollenflug ermittelt. Bei einer Studie von HOFMANN (2007) zur Maispollendeposition wird 56 % der Variation<br />
allein über die Entfernung erklärt: den Faktoren, die die Maispollenausschüttung beeinflussen wie Sorte,<br />
Feldgröße und Reifung, sowie jenen die die Pollenausbreitung bestimmen, wie Wind, Temperatur,<br />
Luftfeuchtigkeit, Topografie, Sink- und Depositionsgeschwindigkeit, kommen nur untergeordnete Bedeutung zu.<br />
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich diese zitierte Studie nicht auf die Messung der tatsächlichen Auskreuzung<br />
bezieht sondern auf die des Pollenfluges, der mittels technischer Pollensammler bestimmt wird.<br />
In einer Studie von SEARS und STANLEY-HORN (2000) wurde der Pollenflug bei sieben verschiedenen Maisfeldern<br />
mittels mit Klebern versehenen Petrischalen in einem Zeitraum von zwei Wochen untersucht, wobei die<br />
Hauptpollenausschüttung in den ersten fünf Tagen auftrat. 84-92 % des Pollens wurde in einer Entfernung von<br />
5 m vom Spenderfeld gemessen. 96-99 % verblieben innerhalb eines 25-50 m Radius der Pollenspenderquellen<br />
und kein Pollen flog weiter als 100 m.<br />
BÉNÉTRIX und BLOC (2003) legten ein Design an um aus ihrer Sicht eine „worst case“ Situation zu simulieren:<br />
Gleicher Anbauzeitpunkt und sich daraus ergebend gleicher Blühzeitpunkt der Sorten, keine Pufferzonen, direkt<br />
aneinander grenzende Felder und das Nicht GV Maisfeld lag im Verhältnis zum GV Mais in der Hauptwindrichtung.<br />
98 % des Pollens flog nicht weiter als 10 m. Innerhalb einer Entfernung von 10-12 m zum GVO Feld betrug der<br />
Polleneintrag weniger als 1 %. Bei starkem Wind allerdings betrug die GVO Verunreinigung bis zu einer Distanz<br />
von 25 m mehr als 1 %.<br />
Auch bei einer dreijährigen Studie von HENRY et al. (2003), durchgeführt an 55 Standorten sinkt der<br />
Fremdpolleneintrag rapid in den ersten 20 m und nimmt bei weiterer Entfernung nur mehr langsam ab; dieses<br />
Muster bestätigt sich auch in unserer Studie. Es wurde aber auch noch in einer Entfernung von 200 m GVO<br />
Verunreinigung bis zu 0,42 % festgestellt. Bei einem der Standorte wurde in 650 m Entfernung vom<br />
Pollenspender ein Eintrag von 0,14 % gemessen. Generell wurde als Messmethode die Real-Time PCR eingesetzt.<br />
Die Autoren verweisen darauf, dass eine 200 m Isolation bei Zuckermais und für den biologischen Landbau unter<br />
Umständen nicht ausreicht, und um den Einfluss des „Randeffektes“ zu berücksichtigen eventuell die Beseitigung<br />
der ersten Randreihen in Betracht gezogen werden soll.<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 131 von 154