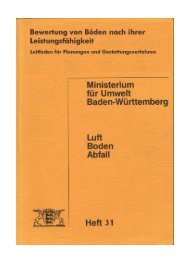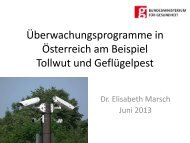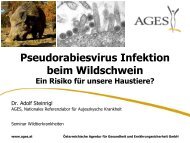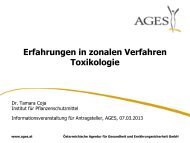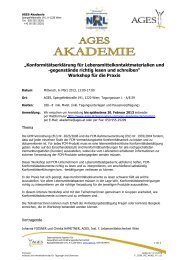Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Material und Methoden<br />
beste Ackerlagen. Teilweise besteht der Oberösterreichische Zentralraum aus Steinfeldern mit extrem dürftigen<br />
Rendsinen, der südliche Bereich wiederum aus sommerwarmen und wintermilden, mäßig feuchten Terrassensockeln<br />
mit Pseudoglyen (BOBEK und MRAS, 1960-1980). Die durchschnittliche Seehöhe beträgt 314 m und die<br />
durchschnittliche Hangneigung 6,2 % (GREIF, 1980).<br />
5.2. Vermessung der Versuchsflächen<br />
Die Versuchsflächen wurden mit Hilfe eines „GPS GM-270, global positioning system“ unter Anwendung der Software<br />
„Farm Works Mate Version 10.22“ vermessen.<br />
Um die Umgebung der Versuchsflächen darzustellen werden Luftbildaufnahmen aus der Basiskarte des Datenpools<br />
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verwendet. Wie aus<br />
Abbildung 10 ersichtlich, werden die Versuchsfläche als Pollenempfänger, die die Versuchsfläche umgebenden<br />
Gelbmaisbestände als Pollenspender und sämtliche andere Kulturen der Umgebungsfelder dargestellt. Weiters ist der<br />
Ausgangspunkt, also der erste Meter in der ersten Reihe der Versuchsfläche markiert sowie die Entfernungen<br />
zwischen der Versuchsfläche zu den umliegenden Maisbeständen. Die Vermessung der Entfernungen erfolgte aus<br />
dem eGIS oder anhand des oben beschriebenen GPS-Gerätes. Die Entfernungen stellen auf +/- 5 Meter auf- bzw.<br />
abgerundete Werte dar.<br />
Versuchsfläche =<br />
Pollenempfänger<br />
Mais<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Getreide Getreide<br />
Soja<br />
���� ����<br />
2<br />
Getreide<br />
Getreide<br />
120m 120m<br />
Getreide 220m 220m<br />
Soja<br />
Soja<br />
Getreide<br />
… Ausgangspunkt (1. Reihe, 1. Meter)<br />
1<br />
Mais<br />
Gelbmaisbestände = Pollenspender<br />
Abbildung 10: Darstellung der Versuchsfläche (= Pollenempfänger) und der sie umgebenden Gelbmaisbestände (=<br />
Pollenspender) sowie deren Entfernung zur Versuchsfläche<br />
5.3. Bestimmung der Blühzeitpunkte<br />
Ab Ende Juni erfolgten einerseits die Bonitur der weiblichen Narbenfäden der Pflanzen auf der Versuchsfläche und<br />
andererseits die Bonitur der männlichen Rispen auf den die Versuchsflächen umgebenden Maisfeldern. Noch vor dem<br />
Erscheinen der ersten Narbenfäden wurden auf jeder Versuchsfläche 4 x 100 Pflanzen markiert. Anhand dieser<br />
Pflanzen wurde der Entwicklungsverlauf der Narbenfäden in Abständen von 3-4 Tagen zeitlich dokumentiert. Das<br />
Boniturschema erfasst anhand der Länge und Frische der Narbenfäden den Zeitraum der Empfängnisfähigkeit.<br />
In den Maisflächen, die aufgrund ihrer Entfernungen zu den jeweiligen Versuchsflächen als Pollenspender in Frage<br />
kamen, wurden ebenfalls 200-300 Pflanzen markiert und in zeitlichen Abständen von 3-4 Tagen bonitiert. Das<br />
Seite 27 von 154