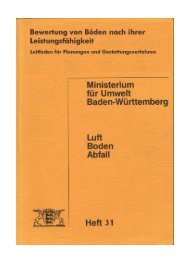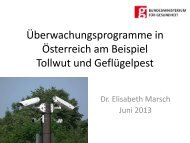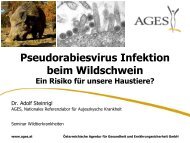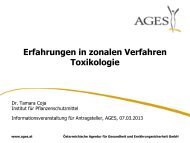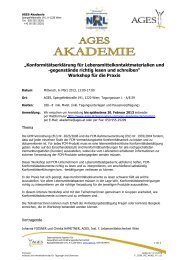Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassung<br />
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Zur Umsetzung eines Koexistenzmanagements für den Fall des Einsatzes von gentechnisch veränderten Maissorten<br />
sind mehrjährige Erfahrungen aus Feldversuchen notwendig um regionale, den österreichischen Anbaubedingungen<br />
für Mais entsprechende Betrachtungen zu ermöglichen. Es wurden zwei unterschiedliche Versuchsdesigns angewandt<br />
um einerseits mit Hilfe eines phänotypischen Markersystems die Fremdbefruchtungsrate, basierend auf einer<br />
bestehenden Ausgangsverunreinigung, andererseits das maximal mögliche Auskreuzungspotential abschätzen zu<br />
können.<br />
Bei Untersuchungen an sechzehn Standorten mit Wachsmaisflächen und zwölf entfahnten Feldstücken in Nieder- und<br />
Oberösterreich, Steiermark und Burgenland wurden folgende Ergebnisse erzielt: Die unerwünschte<br />
Fremdbefruchtung nahm mit der Entfernung signifikant, ab einer Distanz von 100 m aber nur mehr wenig ab. Der<br />
Faktor Distanz bestätigte sich als jener mit dem größten Einfluss auf die Auskreuzungsrate und überdeckte im<br />
vorliegenden Versuch den Einfluss von Wind und Blühpotential. Durch die künstliche Beimpfung eines Teils des<br />
Ausgangssaatgutes wurde der Einfluss einer Ausgangsverunreinigung von 0,5 % geprüft und bei allen beimpften<br />
Flächen lag nach Anpassung der Werte auf DNA Quantifizierungsniveau die Fremdbefruchtungsrate über dem EU<br />
Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9 %. Als geeignete Methode zur Bestimmung der Mindestentfernung erweist<br />
sich - wie schon im Vorläuferprojekt 2005 - die Messung vom nächstliegenden Rand des Pollenspenderfeldes zum<br />
Mittelpunkt der Pollenempfängerfläche. Die Steuerung der Auskreuzungsrate über den Blühverlauf durch<br />
Anbauterminverzögerungen und Sortenwahl ist in unseren Klimaten und Strukturen keine geeignete Maßnahme. Die<br />
durch phänotypische Marker erzielten Ergebnisse sind nicht direkt mit DNA Quantifizierungen vergleichbar und die<br />
jeweils gewählte Methode zur Bestimmung der Auskreuzungsrate ist bei Vergleichen von<br />
Kennzeichnungsschwellenwerten für zufällige, technisch nicht vermeidbare GVO zu berücksichtigen. Die derzeit<br />
international verfügbaren Modelle zur Simulation von Koexistenzszenarien sind in erster Linie von wissenschaftlichem<br />
Wert, für die praktische Landwirtschaft jedoch noch nicht einsetzbar. Die im Entwurf zu den Bundeseinheitlichen<br />
Richtlinien des Koexistenzmanagements vorgeschlagenen Maßnahmen erscheinen als angemessen.<br />
Summary<br />
For implementation of coexistence management measures in the case of intended use of genetically modified maize<br />
perennial field studies are necessary to gain experiences for consideration of regional observations reflecting typical<br />
Austrian growing conditions. Two different field designs were selected: a phenotypical marker system to determine<br />
the cross-fertilization rate based on an existing basic seed impurity and a method to estimate the maximum gene<br />
flow rate.<br />
In Lower and Upper Austria, Styria and Burgenland 16 field trials were conducted using waxy maize as a visual<br />
marker system and 12 experiments were carried out with castrated pollen receptor fields. The undesirable level of<br />
gene flow decreased rapidly with distance but beyond 100 m the rate of decline was much slower. The factor<br />
distance is the one with the highest impact on cross-pollination and was covering the impact of wind and flowering<br />
potential in the present design. The influence of an initial seed impurity of 0,5 % was investigated by artificial<br />
inoculation of part of the seed before planting and all inoculated fields were exceeding the 0,9 % EU labelling<br />
threshold after converting the waxy maize measurements to the DNA based quantification level. A suitable way to<br />
determine minimum distance is to measure the distance between the field border of the pollen donor field and the<br />
centre of the pollen acceptor field; this is confirming the results of the precedent study in 2005. Separating flowering<br />
times by means of planting delays or variety selection does not seem to be an effective tool in our climatic conditions<br />
and agricultural structures. Results obtained by phenotypical markers are not directly comparable with ones from<br />
DNA quantifications and the selected testing method has to be considered when comparing labelling thresholds for<br />
GMO adventitious presence. Current models for forecasting and describing coexistence scenarios are of scientific<br />
value primarily and not yet ready to use for agricultural practice. The proposed measures in the Draft of The National<br />
Guidelines for Coexistence Management seem to be appropriate.<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 3 von 154