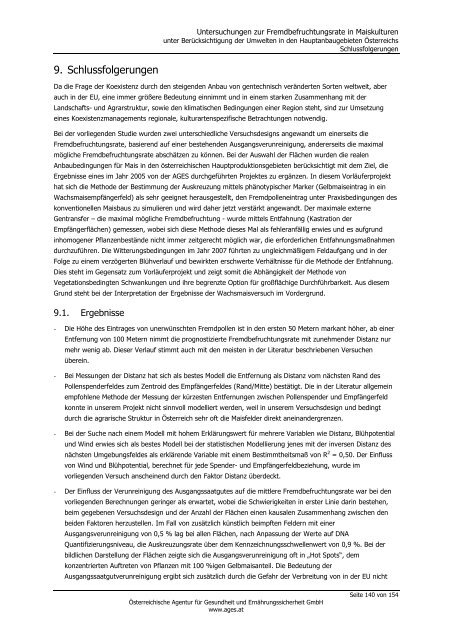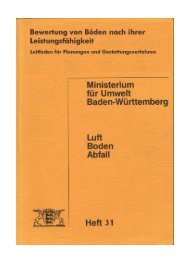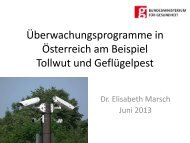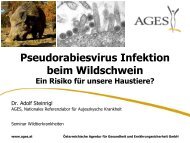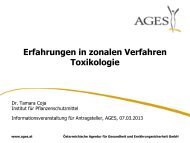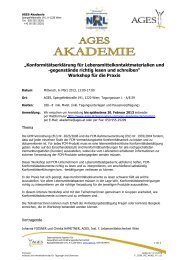Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9. Schlussfolgerungen<br />
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Schlussfolgerungen<br />
Da die Frage der Koexistenz durch den steigenden Anbau von gentechnisch veränderten Sorten weltweit, aber<br />
auch in der EU, eine immer größere Bedeutung einnimmt und in einem starken Zusammenhang mit der<br />
Landschafts- und Agrarstruktur, sowie den klimatischen Bedingungen einer Region steht, sind zur Umsetzung<br />
eines Koexistenzmanagements regionale, kulturartenspezifische Betrachtungen notwendig.<br />
Bei der vorliegenden Studie wurden zwei unterschiedliche Versuchsdesigns angewandt um einerseits die<br />
Fremdbefruchtungsrate, basierend auf einer bestehenden Ausgangsverunreinigung, andererseits die maximal<br />
mögliche Fremdbefruchtungsrate abschätzen zu können. Bei der Auswahl der Flächen wurden die realen<br />
Anbaubedingungen für Mais in den österreichischen Hauptproduktionsgebieten berücksichtigt mit dem Ziel, die<br />
Ergebnisse eines im Jahr 2005 von der AGES durchgeführten Projektes zu ergänzen. In diesem Vorläuferprojekt<br />
hat sich die Methode der Bestimmung der Auskreuzung mittels phänotypischer Marker (Gelbmaiseintrag in ein<br />
Wachsmaisempfängerfeld) als sehr geeignet herausgestellt, den Fremdpolleneintrag unter Praxisbedingungen des<br />
konventionellen Maisbaus zu simulieren und wird daher jetzt verstärkt angewandt. Der maximale externe<br />
Gentransfer – die maximal mögliche Fremdbefruchtung - wurde mittels Entfahnung (Kastration der<br />
Empfängerflächen) gemessen, wobei sich diese Methode dieses Mal als fehleranfällig erwies und es aufgrund<br />
inhomogener Pflanzenbestände nicht immer zeitgerecht möglich war, die erforderlichen Entfahnungsmaßnahmen<br />
durchzuführen. Die Witterungsbedingungen im Jahr 2007 führten zu ungleichmäßigem Feldaufgang und in der<br />
Folge zu einem verzögerten Blühverlauf und bewirkten erschwerte Verhältnisse für die Methode der Entfahnung.<br />
Dies steht im Gegensatz zum Vorläuferprojekt und zeigt somit die Abhängigkeit der Methode von<br />
Vegetationsbedingten Schwankungen und ihre begrenzte Option für großflächige Durchführbarkeit. Aus diesem<br />
Grund steht bei der Interpretation der Ergebnisse der Wachsmaisversuch im Vordergrund.<br />
9.1. Ergebnisse<br />
- Die Höhe des Eintrages von unerwünschten Fremdpollen ist in den ersten 50 Metern markant höher, ab einer<br />
Entfernung von 100 Metern nimmt die prognostizierte Fremdbefruchtungsrate mit zunehmender Distanz nur<br />
mehr wenig ab. Dieser Verlauf stimmt auch mit den meisten in der Literatur beschriebenen Versuchen<br />
überein.<br />
- Bei Messungen der Distanz hat sich als bestes Modell die Entfernung als Distanz vom nächsten Rand des<br />
Pollenspenderfeldes zum Zentroid des Empfängerfeldes (Rand/Mitte) bestätigt. Die in der Literatur allgemein<br />
empfohlene Methode der Messung der kürzesten Entfernungen zwischen Pollenspender und Empfängerfeld<br />
konnte in unserem Projekt nicht sinnvoll modelliert werden, weil in unserem Versuchsdesign und bedingt<br />
durch die agrarische Struktur in Österreich sehr oft die Maisfelder direkt aneinandergrenzen.<br />
- Bei der Suche nach einem Modell mit hohem Erklärungswert für mehrere Variablen wie Distanz, Blühpotential<br />
und Wind erwies sich als bestes Modell bei der statistischen Modellierung jenes mit der inversen Distanz des<br />
nächsten Umgebungsfeldes als erklärende Variable mit einem Bestimmtheitsmaß von R 2 = 0,50. Der Einfluss<br />
von Wind und Blühpotential, berechnet für jede Spender- und Empfängerfeldbeziehung, wurde im<br />
vorliegenden Versuch anscheinend durch den Faktor Distanz überdeckt.<br />
- Der Einfluss der Verunreinigung des Ausgangssaatgutes auf die mittlere Fremdbefruchtungsrate war bei den<br />
vorliegenden Berechnungen geringer als erwartet, wobei die Schwierigkeiten in erster Linie darin bestehen,<br />
beim gegebenen Versuchsdesign und der Anzahl der Flächen einen kausalen Zusammenhang zwischen den<br />
beiden Faktoren herzustellen. Im Fall von zusätzlich künstlich beimpften Feldern mit einer<br />
Ausgangsverunreinigung von 0,5 % lag bei allen Flächen, nach Anpassung der Werte auf DNA<br />
Quantifizierungsniveau, die Auskreuzungsrate über dem Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9 %. Bei der<br />
bildlichen Darstellung der Flächen zeigte sich die Ausgangsverunreinigung oft in „Hot Spots“, dem<br />
konzentrierten Auftreten von Pflanzen mit 100 %igen Gelbmaisanteil. Die Bedeutung der<br />
Ausgangssaatgutverunreinigung ergibt sich zusätzlich durch die Gefahr der Verbreitung von in der EU nicht<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 140 von 154