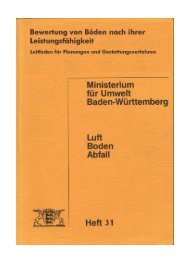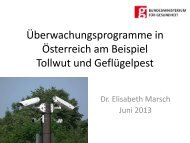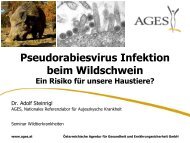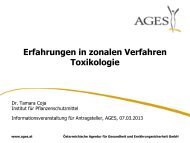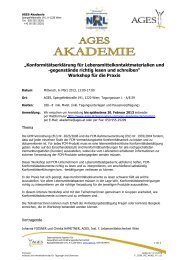Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
Als Randeffekt wird in der Literatur die relativ hohe Auskreuzung am Feldrand bezeichnet, die mit zunehmender<br />
Distanz von der Pollenquelle exponentiell abnimmt. Eine genauere Beschreibung dieses Phänomens, sowie den<br />
möglichen Einfluss einer Beseitigung von Randreihen, findet sich auch im vorliegenden Ergebnisteil der<br />
Versuchsflächen W08 und W09 (Abbildung 43 und Tabelle 17) sowie als weitere Beispiele bei den<br />
Wachsmaisflächen W03 und W11 (siehe Ergebnisteil 6.1). Ergebnisse der ETH Zürich zeigen, dass die<br />
Auskreuzungsrate in allen Versuchen bereits nach 25 m unter 0,5 % lagen, bei einem Vergleich von mehr als<br />
zehn international durchgeführten Studien im Zeitraum von 2002 bis 2004 wurde ermittelt, dass eine Distanz von<br />
50 m ausreicht um die durchschnittliche Auskreuzungsrate bei Mais unter 0,5 % zu halten. Die Autoren<br />
empfehlen diese durchschnittliche Rate von 0,5 % am Feld nicht zu überschreiten, um den Maximalwert von<br />
0,9 % im Erntegut einhalten zu können (vgl. SANVIDO et al., 2005).<br />
8.2.2. Einfluss von Wind<br />
In Simulationsmodellen (z.B. MAPOD®, siehe MESSEAN et al., 2006) wird Wind als ein Hauptfaktor für die Mais-<br />
Auskreuzung angesehen. Nichtsdestotrotz gelten von allen windbestäubenden Kulturarten die Maispollen als jene,<br />
die am schnellsten absinken, vermutlich aufgrund von Größe und Gewicht. DI-GIOVANNI et al. (1995) berichten,<br />
dass Maispollen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30,95 cm/s zehn Mal schneller absanken als<br />
andere Pollentypen.<br />
EMBERLIN und Mitarbeiter (1999) haben in einem Modell berechnet, dass bei durchschnittlichen<br />
Wetterbedingungen in Großbritannien eine Pollenbewegung von 7,2 km in einer Stunde möglich ist, unter der<br />
Annahme, dass eine Windgeschwindigkeit von 2 m/s ausreicht um den Pollen in der Luft zu halten. Bei<br />
Windgeschwindigkeiten von 10 m/s könnten Luftturbulenzen den Pollen länger in der Luft halten und dieser<br />
könnte in einer Stunde 36 km weit fliegen. Im Vergleich dazu sei als österreichisches Beispiel für Windverhältnisse<br />
der pannonische Klimaraum genannt, der sich durch eine fast ständige Windbewegung mit einem Jahresmittel<br />
zwischen 2,5 und 4,0 m/s auszeichnet und in dem sechs unserer Versuchsflächen lagen.<br />
Besonders hervorzuheben sind thermisch bedingte Aufwinde, die die Pollen in höhere Luftschichten transportieren<br />
und somit weit verbreiten können (siehe AYLOR et al., 2006). Dieses Phänomen war in unserem Projekt nicht<br />
eindeutig ersichtlich, die dargestellten Hot Spots rührten in erster Linie von der Beimpfung des<br />
Ausgangssaatgutes her. Französische Untersuchungen mittels flugzeuggetragenen Pollensammlern zeigten, dass<br />
Maispollen bis in 1800 m Höhe getragen wurden, nach einer Schätzung der Autoren wäre dadurch ein<br />
Transportweg von Dutzenden von Kilometern möglich (BRUNET et al., 2003).<br />
BÉNÉTRIX et al. (2005) bestimmten bei ihren Messungen wie folgt: lag das GVO Feld direkt in der<br />
Hauptwindrichtung zum Nicht GVO Feld mit Windaufkommen während der Blüte, betrug die Auskreuzung weniger<br />
als 1 % in den ersten 10-12 m. Verlief die Hauptwindrichtung vom Nicht GV Feld zum GV Feld, betrug die<br />
Auskreuzung weniger als 1 % in den ersten 5-7 m. Bei starken Windverhältnissen (mit Wind vom GV zum Nicht<br />
GV Feld) war die Auskreuzung bis zu einer Entfernung von 25 m größer als 1 %.<br />
Auch beim deutschen Erprobungsanbau 2005 machte man ungünstige Windverhältnisse für höhere<br />
Auskreuzungsraten als beim Versuch im Jahr davor, verantwortlich. HOYLE et al. (2007) von der englischen<br />
Universität Exeter analysierten Windrichtung- und Geschwindigkeitsdaten europäischer Wetterstationen und<br />
verweisen auf die hohe Variation von Jahr zu Jahr, aber auch bei Versuchswiederholungen innerhalb der selben<br />
zeitlichen Periode.<br />
Bei HENRY et al. (2003) zeigte sich in dem dreijährigen, auf 55 Flächen durchgeführten Versuch, dass ein großer<br />
Zusammenhang zwischen Auskreuzung und während der Blühübereinstimmung herrschende Hauptwindrichtung<br />
bestand. Der Einfluss von Topographie und agrarischer Landschaft auf die tägliche Schwankung von<br />
Windgeschwindigkeit und Turbulenzen ist allerdings kaum vorhersagbar.<br />
In unserem Projekt war es bei der Modellierung nicht möglich, die Faktoren Distanz und Wind so getrennt zu<br />
berücksichtigen, dass ein eindeutiger Einfluss nachgewiesen werden konnte.<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 132 von 154