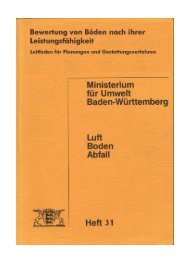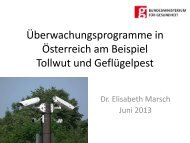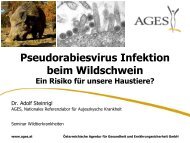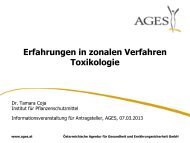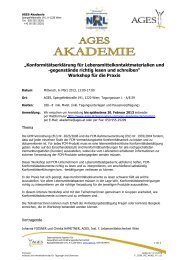Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
Bereits 1952 haben JONES und BROOKS den Einfluss von Bäumen als Barrieren für Pollenflug untersucht und<br />
festgestellt, dass eine einzelne Baumreihe mit Buschunterwuchs die Fremdbefruchtung hinter der Barriere um<br />
50 % reduzierte. Die Reduktion war noch größer, wenn Pufferreihen angebaut wurden, die zusätzlich<br />
„Konkurrenz“-Pollen lieferten.<br />
MESSEGUER et al. (2006) haben in ihrem Design einen deutlichen reduzierenden Effekt auf die Pollenvertragung<br />
durch eine Allee mit 2 m hohen Bäumen festgestellt, TREU und EMBERLIN (2000) bestätigen die<br />
„Pollenfilterwirkung“ von physischen Barrieren wie zum Beispiel Baumbeständen und Hecken.<br />
LANGHOF et al. (2008) haben den Einfluss verschiedener Zwischenkulturen zur Feststellung von Randeffekten<br />
mittels Klee/Gras- und Sonnenblumenstreifen untersucht. Dabei wurde ein Gelbmaisfeld mit Blöcken von<br />
Sonnenblumen und Klee-Grasmischung ummantelt und somit von einem Weißmaisempfängerstreifen getrennt;<br />
das Design wurde in einem zweiten „Mantel“ wiederholt. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen niedrig<br />
und hochwachsenden Kulturen, beide Kulturen stellten keine wirksame Maßnahme dar um die Auskreuzung zu<br />
verhindern. Randeffekte traten auch auf, wenn die Ränder des Maisfeldes durch eine hochwachsende Kultur wie<br />
die Sonnenblume verdeckt sind.<br />
GANZ et al. (2007) untersuchten die Wirkung unterschiedlicher Kulturen wie Kartoffel, Gras, Sommergerste und<br />
Erbse als Puffer, durch die extremen Windverhältnisse wurden aber alle anderen Einflussfaktoren verdeckt. Die<br />
Auswahl der Pufferkulturen brachte keinen Einfluss auf die Auskreuzungsrate.<br />
In unserem Versuch war die Auswahl der Fläche E07 so angelegt, dass ein Einfluss von Windschutzgürtel getestet<br />
werden sollte (siehe Abbildung 84a in Kapitel 6.2.6). Leider war es aufgrund von Entfahnungsproblemen bei<br />
dieser Fläche nicht möglich, die Wirksamkeit dieser „Abschirmungen“ zu prüfen. Die Flächendarstellung von W15<br />
zeigt, dass trotz einer Baum- und Sträuchergruppe als Pufferzone ein hoher Polleneintrag vom Westen erfolgte<br />
(siehe Abbildung 62, Kapitel 6.1.13).<br />
MESSEAN et al. (2006) empfehlen als Pufferzonen den Anbau eines Nicht GV Mantels, obwohl bei ungünstigen<br />
Windbedingungen eine Zone von 18 m nicht ausreichte um unter dem 0,9 % Kennzeichnungswert zu bleiben.<br />
Dies zeigte sich besonders bei kleinen Feldern mit einer großen Zahl von GV Nachbarfeldern. Als weitere Barriere<br />
wird der Einsatz von CMS Hybriden bei den GVO Sorten angedacht, männlich sterile Hybriden, die mit der fertilen<br />
Variante des Hybriden vermischt werden. Unter der Annahme einer 75 %igen CMS (zytoplasmatisch männliche<br />
Sterilität) würden 75 % weniger Pollen ausgeschüttet werden als bei herkömmlichen GV Sorten.<br />
Als besonders effektiv wird der Einsatz von Maisreihen als Puffer auch darum gesehen, weil durch den<br />
Pollendruck dieser Pufferreihen eine natürliche Barriere geschaffen wird. Laut BROOKES et al. (2004) entspricht<br />
eine Pufferreihe einer Isolation von 10 m. Diese Technik wird auch oft in der Saatgutproduktion eingesetzt, wo<br />
man mehrere Reihen der männlichen Linie am Feldrand anbaut um das gewünschte Pollenangebot zu erhöhen.<br />
Laut BURRIS (2002) ist die Wirkung des Einsatzes von Randreihen allerdings limitiert: eine größere Zahl als die in<br />
der amerikanischen Saatgutproduktion üblichen sechs Randreihen zeigt in seinen Untersuchungen wenig Effekt.<br />
Spanische Daten erachten eine Pufferzone von vier Reihen Nicht GV Mais als eine geeignete<br />
Koexistenzmaßnahme bei Feldgrößen unter 1 ha und wenn die Entfernung zwischen Spender und Empfängerfeld<br />
kleiner als 25 m ist (vgl. BROOKES et al., 2004).<br />
Für österreichische Verhältnisse ist, speziell in Gemeinden mit durchschnittlichen Schlaggrößen von ca. 0,5 ha wie<br />
man sie z.B. in der östlichen Steiermark findet, der Einsatz von Pufferreihen, die separat geerntet werden sollen,<br />
besonders aus ökonomischer Sicht zu hinterfragen. Es bleibt auch die Frage offen, wie diese Pufferreihen<br />
klassifiziert werden sollen und was mit dem geernteten Material dann passieren soll. Speziell bei Betrieben die<br />
Mais für die Fütterung des eigenen Viehbestandes einsetzen, erscheint diese Option wenig sinnvoll und<br />
praxisgerecht.<br />
8.3. Einfluss der Ausgangsverunreinigung<br />
Die Verwendung von zertifiziertem Saatgut bietet dem Anwender Sicherheit durch einen definierten<br />
Reinheitsgrad, der rechtlich festgelegt ist und behördlich überprüft wird. Die Anforderungen zur Produktion sind<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 136 von 154