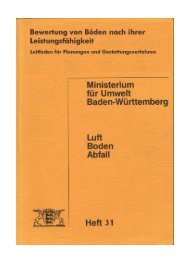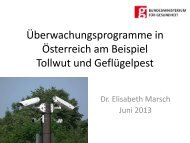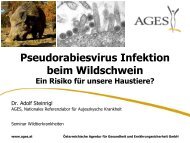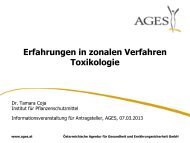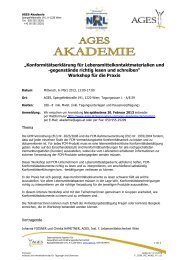Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
reduzierte die Fremdbefruchtung auf einen nahezu nicht nachweisbaren Wert. Als Schlussfolgerung erklären die<br />
Autoren, in klimatischen Gebieten, die einen Anbau zwischen Märzbeginn und frühen Mai zulassen, eine<br />
Zeitspanne von 10 Tagen zwischen der Blüte als ausreichend um eine unerwünschte Auskreuzung zu verhindern.<br />
Für österreichische Bedingungen erweist sich diese Empfehlung als nicht praxisrelevant, da unsere Klimate es<br />
nicht erlauben, Mais bereits so früh anzubauen, ohne ein Risiko den Feldaufgang betreffend einzugehen.<br />
Auch BROOKES et al. (2004) zitieren eine unveröffentlichte Studie von APROSE (2004) bei der der Einfluss von<br />
Zeitverzögerungen beim Anbau zu Verzögerung bei der Blüte führt und somit eine gewisse Befruchtungslenkung<br />
möglich ist. MESSEGUER et al. (2006) sehen allerdings eine Einschränkung dieser Strategie durch die klimatischen<br />
Verhältnisse in einer Region gegeben. Für Südeuropa scheint diese Strategie besser geeignet zu sein, weil die<br />
Wahlmöglichkeiten bei den Anbauterminen und auch beim Einsatz bestimmter Sorten, bedingt durch die generell<br />
längere Vegetationsperiode, größer sind.<br />
Die französische Nationale Interprofessionelle Vereinigung für Samen und Pflanzen GNIS (Groupement National<br />
Interprofessionnel des Semences, 2003) empfiehlt den französischen Maisproduzenten eine zeitliche Isolation<br />
speziell durch die Sortenwahl. Der unterschiedliche Reifegrad der Sorten wird als effektiver zur<br />
Befruchtungslenkung gesehen als versetzte Anbautermine, allerdings auch generell mit der Einschränkung, dass<br />
diese Praxis im südlichen Europa leichter umzusetzen ist als in nördlicheren Breitengraden.<br />
8.2.5. Einfluss von Feldgrößen und -umfang<br />
In einer Reihe von Studien wird darauf hingewiesen, dass die Auskreuzungsrate stark von der Feldgröße<br />
beeinflusst werden könnte. MESSEGUER et al. (2006) führen einen Versuch mit kleinen Feldgrößen (0,5 – 4 ha)<br />
durch und empfehlen, bei diesen Größen 10 m des Feldrandes nicht zu ernten um eine signifikante Reduktion des<br />
GVO Gehaltes des Erntegutes zu bewirken. Die Auskreuzungssrate erweist sich als höher bei länglich gestreckten<br />
Empfängerfeldern, wenn die Längsseite dem Spenderfeld zugewandt ist, als bei quadratischen Feldformen. Dies<br />
wird auch in anderen Experimenten bestätigt: je länger die gemeinsame Grenze zwischen einem GVO und Nicht<br />
GVO Feld ist, umso höher die Chance der Auskreuzung (BROOKES et al., 2004); vgl. auch die Flächenkonstellation<br />
bei E03 unter 6.2.3 dieses Berichtes.<br />
BANNERT (2006) hat in seiner in der Schweiz durchgeführten Studie den Einfluss verschiedener<br />
Spender:Empfänger-Verhältnisse untersucht. So wurde zum Beispiel ein Teil eines Weißmaisfeldes einmal mit<br />
einem 9 m breiten Streifen Gelbmais umgeben, der zweite Teil des Feldes mit 30 m Gelbmais ummantelt, in<br />
ähnlicher Weise wurden noch andere Größenverhältnisse simuliert. Die Ergebnisse zeigten allerdings keine<br />
Unterschiede zwischen den Felddesigns, generell war die Auskreuzungsrate in den ersten 10 m am höchsten. Es<br />
wurde vermutet, dass ein größerer Einfluss des Feldgrößenverhältnisses in Wind exponierten Lagen zu erwarten<br />
sei.<br />
In einer spanischen Studie, beauftragt durch die Regionalregierung in Katalonien, haben MELÉ und Mitarbeiter<br />
(2004) als Schlussfolgerung festgestellt, dass bei Empfängerfeldern, die kleiner als 1 ha sind, eine<br />
unterschiedliche Vorgangsweise zu empfehlen sei als bei Feldern größer als ein Hektar. Bei kleinen Flächen (0,25<br />
ha) die direkt an ein GVO Spenderfeld anschlossen, betrug die Durchschnittsverunreinigung für die gesamte<br />
Fläche 1,77 % und ein Trennstreifen von 6 m wird empfohlen um das Erntegut unter der EU<br />
Kennzeichnungsvorschrift zu halten. Bei größeren Feldern wird kein Trennstreifen als notwendig erachtet.<br />
JEMISON und VAYDA (2001) führten einen Versuch durch, bei dem das Pollenspenderfeld ca. 17 mal größer als das<br />
Empfängerfeld war. In diesem speziellen Fall betrug der Mittelwert der Auskreuzung bei einer Entfernung von<br />
mehr als 50 m 0,24 %, mit einigen Datenpunkten noch über 0,5 %, steht also im Widerspruch zu den von<br />
SANVIDO et al. (2005) verglichenen Studien, bei denen eine Distanz von 50 m ausreichte um eine<br />
Auskreuzungsrate von < 0,5 % zu erreichen. Interpretiert wird dieser Widerspruch durch die spezielle<br />
Feldgrößensituation. Generell gilt: je größer das Empfängerfelder, umso größer die eigene Pollenmasse, die wie<br />
eine Wolke über dem Feld liegt und als physikalische Barriere wirkt (DEVOS, 2008).<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 134 von 154