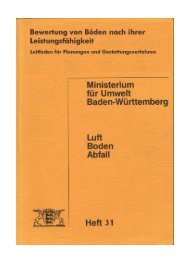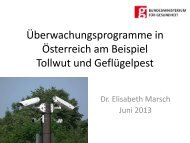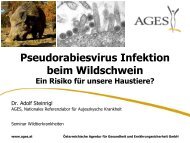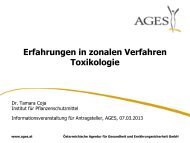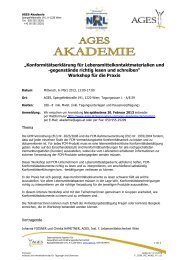Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8.2.3. Pollenlebensfähigkeit<br />
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
Die Methode der entfahnten Flächen stellte ein Versuchsdesign dar, dass automatisch die Lebensfähigkeit des<br />
Pollens evaluiert. Einige Studien haben sich damit beschäftigt, Einflussfaktoren wie Temperatur und relative<br />
Luftfeuchtigkeit zu prüfen und auch den Zusammenhang zwischen Lebensfähigkeit und Feuchtigkeitsgrad des<br />
Pollen selbst zu untersuchen. Eine Maispflanze produziert zwischen 4,5 und 25 Millionen Pollenkörner innerhalb<br />
eines Zeitraumes von fünf bis acht Tagen (PATERNIANI et al., 1974) und der Pollen bleibt normalerweise 24<br />
Stunden lebensfähig. FOUEILLASSAR und Mitarbeiter (2005 und 2007) bestätigen, dass lebensfähiger Pollen einen<br />
höheren Feuchtigkeitsgrad als nicht lebensfähiger aufweist und somit schwerer ist und schneller zu Boden sinkt.<br />
Bei einer minimalen Windgeschwindigkeit von 2 m/s sank der größte Teil der lebensfähigen Pollen bereits nach<br />
0,5 und 2 m zu Boden.<br />
Bei trockenen heißen Klimabedingungen kann die Lebensfähigkeit bereits nach einigen Stunden beendet sein; ein<br />
Versuch, bei dem Pollen direkter Sonneneinstrahlung und einer Temperatur von 35°C ausgesetzt war, bewirkte,<br />
dass er nur drei Stunden befruchtungsfähig blieb, während bei kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit<br />
die Lebensfähigkeit auf bis zu neun Tage ausgeweitet wurde (vgl. EMBERLIN et al., 1999).<br />
Auswaschungen durch Regen wirkt sich negativ auf die Lebensfähigkeit aus. Berichte aus der Maisproduktion<br />
bestätigen, dass lange Regenperioden während der Blütezeit zu niedrigeren Befruchtungsraten führen. Wenn<br />
man Pollenkörner in reines Wasser gibt, erfolgt eine rapide Wasseraufnahme, die zum Aufplatzen der<br />
Pollenkörner führt und bewirkt, dass diese nicht mehr auskeimen können (BANNERT, 2006). Wenn Pollen in<br />
Regentropfen absorbiert wird und/oder auf nassen Narbenfäden landet, kann keine Befruchtung stattfinden<br />
(DEVOS, 2008).<br />
VINER et al. (2007), Iowa State University, entwickelten ein Modell - kombiniert aus einem hydrodynamischen,<br />
einem Partikelverteilungs- und Pollenlebensfähigkeitsmodell - zur Einschätzung der möglichen Pollenvertragung<br />
von einem Quellenfeld. Ergebnisse zeigen, dass kleine Pollenmengen bis zu 5 km vertragen werden können und<br />
30 % davon lebensfähig bleiben. Die Lebensfähigkeit wird damit erklärt, dass Pollen durch thermische<br />
Turbulenzen einige hunderte Meter hoch in kühle feuchte Luftschichten getragen werden und die<br />
Umgebungsbedingungen sich dadurch begünstigend auswirken.<br />
8.2.4. Blühverlauf<br />
Der Einfluss des Blühpotentials war in unseren Daten weniger bestimmend als erwartet. Generell kam es bei<br />
beinahe allen Flächen zu einer gemeinsamen Blüte von Spender- und Empfängerfeld; es zeigt sich, dass bereits<br />
eine relative kurze Zeitdauer der Blühübereinstimmung für die Befruchtung ausreicht. Eine Ausnahme in der<br />
Blühübereinstimmung war die Versuchsfläche W13 - das Feld mit der niedrigsten Fremdbefruchtungsrate im<br />
gesamten Versuch - ein Bestand, der einige Tage früher blühte als die angrenzenden Felder (siehe 6.1.10).<br />
Generell gilt für unsere agrarische Situation, dass die Anbauzeitpunkte und Sortenwahl der österreichischen<br />
Landwirte, sowie klimatische Voraussetzungen bewirken, dass es zu keinen großen Unterschieden bei der<br />
Bestandesentwicklung in einer Region kommt.<br />
WEBER und BRINGEZU (2005) berichten, während des Erprobungsanbaues 2004 verschiedene Anbaudaten für BT-<br />
Mais und konventionellen Mais versucht zu haben um die männliche Blüte des GV Maises und die weibliche der<br />
konventionellen Sorte zu kontrollieren und Blühübereinstimmung zu verhindern. Durch die speziellen klimatischen<br />
Bedingungen im Versuchsgebiet im Jahr 2004 kam es allerdings zu verzögerter Pflanzenentwicklung in der frühen<br />
Phase, die zu einer Überlappung der Blühphasen an allen Standorten führte. Es war nicht möglich, mittels<br />
Steuerung der Anbaudaten bzw. über die Sortenwahl eine ausreichende Beeinflussung des Blühverlaufes<br />
herbeizuführen.<br />
PALAUDELMAS et al. (2007) haben in einem spanischen Versuch mit Gelb-und Weißmais drei verschiedene<br />
Anbaudaten im Abstand von 20 Tagen (31. März, 20. April und 11. Mai) getestet. Aufgrund der kalten Witterung<br />
im April führte diese Staffelung zwischen den ersten beiden Anbauterminen zu einer Blühzeitpunktverschiebung<br />
von nur drei bis vier Tagen. Erst der Anbau im Mai bewirkte eine Verschiebung der Blüte um 10 Tage und<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 133 von 154