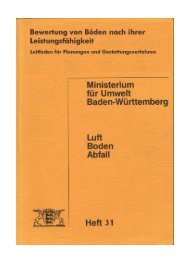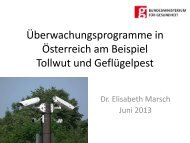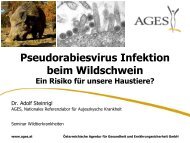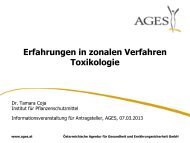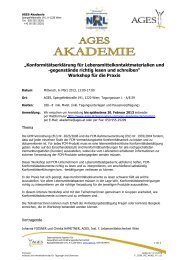Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
von 0,5 % - die zufällige technisch nicht vermeidbare Verunreinigung des Saatgutes maximal 0,3 % betragen soll<br />
(vgl. MESSEAN at al., 2006). Auch Schweizer Autoren ziehen einen Toleranzwert für Saatgut von 0,3 % in Betracht,<br />
speziell unter der Annahme, dass sich GVO Einträge während der verschiedenen Schritte in der Produktionskette<br />
bis zum Ernteprodukt akkumulieren (SANVIDO et al., 2005).<br />
GIRSCH et al., (2004) erachten die in einem Bericht des wissenschaftlichen Pflanzenausschusses der<br />
EU Kommission (SCP/GMO-SEED-CONT/002-FINAL 2001) geschätzten potentiellen Kontaminationsraten bei der<br />
Feldproduktion als zu optimistisch:<br />
- Ausgangssaatgut 0,3 %<br />
- Anbau und Kultivierungsmaßnahmen, sowie Durchwuchs 0 %<br />
- Fremdbefruchtung 0,2 %<br />
- Ernte, Transport und Lagerung jeweils 0,01 %<br />
und es wird darauf hingewiesen, dass das Verunreinigungsrisiko bei Ausgangssaatgut aus Drittländern, die bereits<br />
einen hohen Anteil an GVO Sorten haben, naturgemäß größer ist als bei Saatgut aus Österreich, wo derzeit kein<br />
GVO-Anbau stattfindet. Die Gefahr des Auftretens von in der EU nicht zugelassenen GVO ist dadurch gegeben,<br />
dass die Mehrheit der Maiszüchter mit Zuchtgärten in Drittländern arbeitet.<br />
8.4. Koexistenzszenarien<br />
Die derzeit eingesetzten Modelle wie MAPOD® (ANGEVIN et al., 2003 und MESSEAN et al., 2006) zur Vorhersage<br />
von Verbreitung und Verhalten von Transgenen in der Agrarlandschaft gelten als effizient für Simulationen (vgl.<br />
SIGMEA, WP 4) und wirksam zur Entwicklung von technischen Empfehlungen zur Koexistenz bei Anbau und<br />
Ernte. Diese Modelle berücksichtigen die räumliche Verbreitung der Transgene in Zusammenhang mit der<br />
eingesetzten Agrartechnik und den klimatischen Bedingungen, sowie die Sortencharakteristika (Blühzeitpunkt und<br />
–verlauf).<br />
Als Einstieg wird der Zeitpunkt der weiblichen Blüte als eine Funktion von Anbaudatum und klimatischen Daten<br />
bestimmt. Darauf basierend und davon ausgehend, dass bei den meisten derzeit verwendeten Sorten bedingt<br />
durch Protandrie die männliche Blüte bereits einige Tage vor der weiblichen beginnt, wird der Blühverlauf für die<br />
männliche Blüte berechnet. Durch diese Modellierung kann die vermutliche befruchtungsfähige Pollenmenge der<br />
GVO und Nicht GV Sorten, sowie die Empfängnisfähigkeit der Narbenfäden kalkuliert werden, und auf täglicher<br />
Basis ist die Beschaffenheit der Pollenwolke während des gesamten Blühverlaufes bekannt. Die Pollenverbreitung<br />
wird durch die Gleichung von KLEIN (2000, 2003) simuliert, sie wird berechnet als eine Funktion von Entfernung<br />
zum Spender und mittels Parameter wie durchschnittliche Windrichtung und –geschwindigkeit während der<br />
gesamten Blüte, sowie die Höhendifferenz zwischen Rispe und Narbenfäden bei den eingesetzten Sorten. Die<br />
Pollenwolke wird durch eine Verbreitungskurve auch für die Nachbarfelder beschrieben. Damit wird täglich die<br />
Befruchtungsrate ermittelt und der Anteil der GVO Samen im Erntegut geschätzt. Es sind also zahlreiche<br />
Inputdaten wie z.B. Feldpläne, Klimadaten wie Temperatur, Niederschlag und Windverhältnisse, Beschreibung der<br />
Sorten - morphologisch und physiologische Eigenschaften – sowie landwirtschaftliche Daten wie Anbauzeitpunkt<br />
und Aussaatmenge, notwendig.<br />
Als limitierend für das Modell werden folgende Faktoren angesehen (siehe SIGMEA, WP4):<br />
- Die Daten basieren auf Auskreuzungsstudien, die mit kurzen Distanzen durchgeführt wurden. Modellierungen<br />
für größere Entfernungen müssen noch verbessert werden.<br />
- Die Durchführung von Simulationen in größerer Zahl ist noch sehr zeitraubend und bedarf einer Verbesserung.<br />
- Derzeit erfolgt die Flächenbeschreibung über ein Koordinatensystem, das sehr viel Zeitaufwand bedeutet.<br />
Verbindungen zu gängigen GIS Datensystemen müssen hergestellt werden.<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 138 von 154