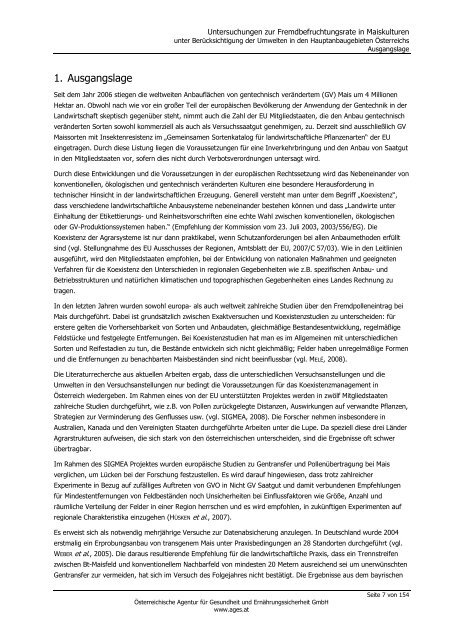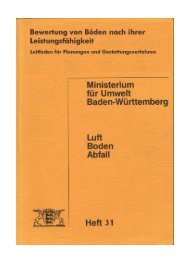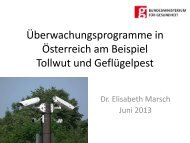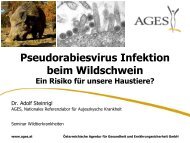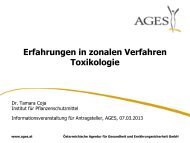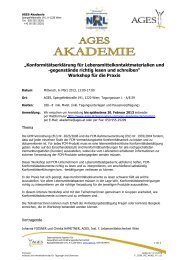Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Ausgangslage<br />
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Ausgangslage<br />
Seit dem Jahr 2006 stiegen die weltweiten Anbauflächen von gentechnisch verändertem (GV) Mais um 4 Millionen<br />
Hektar an. Obwohl nach wie vor ein großer Teil der europäischen Bevölkerung der Anwendung der Gentechnik in der<br />
Landwirtschaft skeptisch gegenüber steht, nimmt auch die Zahl der EU Mitgliedstaaten, die den Anbau gentechnisch<br />
veränderten Sorten sowohl kommerziell als auch als Versuchssaatgut genehmigen, zu. Derzeit sind ausschließlich GV<br />
Maissorten mit Insektenresistenz im „Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten“ der EU<br />
eingetragen. Durch diese Listung liegen die Voraussetzungen für eine Inverkehrbringung und den Anbau von Saatgut<br />
in den Mitgliedstaaten vor, sofern dies nicht durch Verbotsverordnungen untersagt wird.<br />
Durch diese Entwicklungen und die Voraussetzungen in der europäischen Rechtssetzung wird das Nebeneinander von<br />
konventionellen, ökologischen und gentechnisch veränderten Kulturen eine besondere Herausforderung in<br />
technischer Hinsicht in der landwirtschaftlichen Erzeugung. Generell versteht man unter dem Begriff „Koexistenz“,<br />
dass verschiedene landwirtschaftliche Anbausysteme nebeneinander bestehen können und dass „Landwirte unter<br />
Einhaltung der Etikettierungs- und Reinheitsvorschriften eine echte Wahl zwischen konventionellen, ökologischen<br />
oder GV-Produktionssystemen haben.“ (Empfehlung der Kommission vom 23. Juli 2003, 2003/556/EG). Die<br />
Koexistenz der Agrarsysteme ist nur dann praktikabel, wenn Schutzanforderungen bei allen Anbaumethoden erfüllt<br />
sind (vgl. Stellungnahme des EU Ausschusses der Regionen, Amtsblatt der EU, 2007/C 57/03). Wie in den Leitlinien<br />
ausgeführt, wird den Mitgliedstaaten empfohlen, bei der Entwicklung von nationalen Maßnahmen und geeigneten<br />
Verfahren für die Koexistenz den Unterschieden in regionalen Gegebenheiten wie z.B. spezifischen Anbau- und<br />
Betriebsstrukturen und natürlichen klimatischen und topographischen Gegebenheiten eines Landes Rechnung zu<br />
tragen.<br />
In den letzten Jahren wurden sowohl europa- als auch weltweit zahlreiche Studien über den Fremdpolleneintrag bei<br />
Mais durchgeführt. Dabei ist grundsätzlich zwischen Exaktversuchen und Koexistenzstudien zu unterscheiden: für<br />
erstere gelten die Vorhersehbarkeit von Sorten und Anbaudaten, gleichmäßige Bestandesentwicklung, regelmäßige<br />
Feldstücke und festgelegte Entfernungen. Bei Koexistenzstudien hat man es im Allgemeinen mit unterschiedlichen<br />
Sorten und Reifestadien zu tun, die Bestände entwickeln sich nicht gleichmäßig; Felder haben unregelmäßige Formen<br />
und die Entfernungen zu benachbarten Maisbeständen sind nicht beeinflussbar (vgl. MELÉ, 2008).<br />
Die Literaturrecherche aus aktuellen Arbeiten ergab, dass die unterschiedlichen Versuchsanstellungen und die<br />
Umwelten in den Versuchsanstellungen nur bedingt die Voraussetzungen für das Koexistenzmanagement in<br />
Österreich wiedergeben. Im Rahmen eines von der EU unterstützten Projektes werden in zwölf Mitgliedstaaten<br />
zahlreiche Studien durchgeführt, wie z.B. von Pollen zurückgelegte Distanzen, Auswirkungen auf verwandte Pflanzen,<br />
Strategien zur Verminderung des Genflusses usw. (vgl. SIGMEA, 2008). Die Forscher nehmen insbesondere in<br />
Australien, Kanada und den Vereinigten Staaten durchgeführte Arbeiten unter die Lupe. Da speziell diese drei Länder<br />
Agrarstrukturen aufweisen, die sich stark von den österreichischen unterscheiden, sind die Ergebnisse oft schwer<br />
übertragbar.<br />
Im Rahmen des SIGMEA Projektes wurden europäische Studien zu Gentransfer und Pollenübertragung bei Mais<br />
verglichen, um Lücken bei der Forschung festzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass trotz zahlreicher<br />
Experimente in Bezug auf zufälliges Auftreten von GVO in Nicht GV Saatgut und damit verbundenen Empfehlungen<br />
für Mindestentfernungen von Feldbeständen noch Unsicherheiten bei Einflussfaktoren wie Größe, Anzahl und<br />
räumliche Verteilung der Felder in einer Region herrschen und es wird empfohlen, in zukünftigen Experimenten auf<br />
regionale Charakteristika einzugehen (HÜSKEN et al., 2007).<br />
Es erweist sich als notwendig mehrjährige Versuche zur Datenabsicherung anzulegen. In Deutschland wurde 2004<br />
erstmalig ein Erprobungsanbau von transgenem Mais unter Praxisbedingungen an 28 Standorten durchgeführt (vgl.<br />
WEBER et al., 2005). Die daraus resultierende Empfehlung für die landwirtschaftliche Praxis, dass ein Trennstreifen<br />
zwischen Bt-Maisfeld und konventionellem Nachbarfeld von mindesten 20 Metern ausreichend sei um unerwünschten<br />
Gentransfer zur vermeiden, hat sich im Versuch des Folgejahres nicht bestätigt. Die Ergebnisse aus dem bayrischen<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 7 von 154