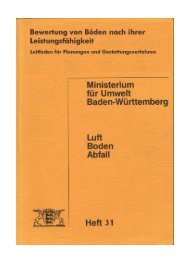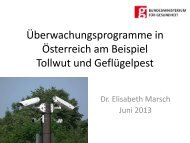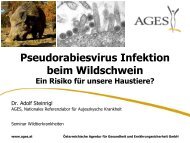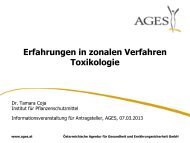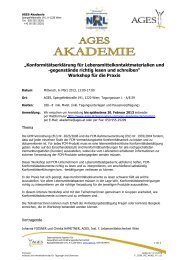Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Download (pdf) - Seltene Landwirtschaftliche Kulturpflanzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Untersuchungen zur Fremdbefruchtungsrate in Maiskulturen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelten in den Hauptanbaugebieten Österreichs<br />
Diskussion<br />
GUSTAFSON et al. (2006) beschreiben in einer Modellierung den Einfluss bei Pollenspenderfeldgrößen von 1, 4, 9<br />
und 16 ha auf ein 16 ha großes Empfängerfeld. In diesen Fällen wäre eine Isolation von 20 m ausreichend um zu<br />
einem GVO Eintrag von kleiner als 0,9 % zu kommen. Wenn das Spenderfeld viel kleiner als das Empfängerfeld<br />
ist, würden die Isolationsanforderungen noch geringer sein; für diesen Fall muss laut Autoren ein neuer<br />
Modellierungsansatz entwickelt werden.<br />
In unserer Studie ist der Einfluss der Feldgröße - wie bereits im Modell 2 beschrieben - nicht festzustellen, und<br />
zwar, wie schon erwähnt, weil bei den ausgewählten Versuchsstandorten zufällig die Entfernung zwischen kleinen<br />
Spenderfeldern und Empfängerfeldern signifikant geringer ist als jene zwischen großen Spender- und<br />
Empfängerfeldern.<br />
Auffallenderweise ist keine unserer Versuchsflächen größer als 2,5 ha, wobei das Design generell an die<br />
kleinflächige Struktur der österreichischen Landwirtschaft angepasst ist. Das Ergebnis mehrerer neuerer Studien,<br />
dass bei Feldgrößen > 5 ha aufgrund von Feldgröße und –tiefe der Gesamtverunreinigungsgehalt des Erntegutes<br />
generell unter 0,9 % bleibt (DEVOS, 2008), kommt bei durchschnittlichen österreichischen Anbauverhältnissen<br />
wenig zum Tragen, bestätigt aber die Empfehlungen im Entwurf der Bundeseinheitlichen Richtlinien des<br />
Koexistenzmanagements.<br />
Schon in der JRC-IPTS Studie (MESSEAN et al., 2006) wird die Möglichkeit des Clustering beim GVO Anbau<br />
untersucht und auch empfohlen: in sogenannten „Inter –Cluster“ Fällen, wenn GV Felder und Nicht GV Felder in<br />
jeweils eigenen Clustern angebaut werden, kann der Fremdpolleneintrag sehr niedrig gehalten werden. Zusätzlich<br />
zum einfacheren Einhalten von Minimumentfernungen kann auch die Verunreinigung durch Erntemaschinen<br />
leichter vermieden, Verunreinigungsgefahren bei überbetrieblichen Maschineneinsatz können also minimiert<br />
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass 10 % GVO Felder, verteilt in einer Landschaft, schwieriger zu handhaben<br />
sind als ein Anteil von 50 % GVO Maisflächen in einer Region, die in einem Cluster gruppiert sind. Die Autoren<br />
gehen speziell auf die kleinräumigen Gegebenheiten in Poitou-Charentes (Südwestfrankreich) ein, das drittgrößte<br />
Körnermaisproduktionsgebiet Frankreichs, wo kleinflächige Felder normalerweise um Bewässerungsquellen<br />
gruppiert sind und somit natürliche Möglichkeiten zur Clusterbildung bieten. Die Ergebnisse der Modellrechnungen<br />
zeigen aber, dass die Einhaltung von sehr niedrigen Grenzwerten, wie sie derzeit auch für Österreich gelten, stark<br />
von den Verhältnissen in den Anbauregionen abhängig ist.<br />
DOLEZEL und Mitarbeiter (2005) haben in einer österreichischen Studie berechnet, dass bereits bei einem 10 %<br />
Anteil von GVO bedingt durch die Isolationsanforderungen ein großer Teil der Maisflächen für den Nicht GVO<br />
Anbau verloren geht, verursacht durch die in Österreich üblichen kleinen Feldflächen und kleinräumige<br />
Strukturen. In den von ihnen untersuchten Testregionen lag die durchschnittliche Feldgröße zwischen 1,1 und<br />
3 ha. Bei einem GVO Anteil von 50 % würden bereits 50 m Isolationsanforderungen eine 35 %ige Reduktion der<br />
Flächenverfügbarkeit für Nicht GVO bewirken.<br />
8.2.6. Pollenbarrieren und Pufferzonen<br />
In den Leitlinien der Kommission vom Juli 2003 (2003/556/EG) wird spezifiziert, dass Landwirte, die die neue<br />
Technologie der gentechnisch veränderten Sorten anwenden, auch die Verantwortung dafür tragen sollen, den<br />
unerwünschten Gentransfer zu limitieren. Eine mögliche Strategie wäre Nicht-GV-Mais um das gesamte GVO Feld<br />
anzubauen und diesen Bereich gleichzeitig für das Refugienmanagement zur Minimierung der Entwicklung<br />
unerwünschter Resistenzen – im Fall von insektenresistenten Bt Mais – zu verwenden (vgl. MESSEAN et al., 2006).<br />
Eine zweite Möglichkeit, die die Autoren vorschlagen, ist das separate Ernten des Randbereiches des Feldes<br />
(siehe BOCK et al., 2002), wobei diese Variante mit höheren Kosten verbunden ist.<br />
In der Saatgutproduktion werden Pufferzonen wie Windschutzgürtel oder Hecken berücksichtigt um eine<br />
Reduktion der Mindestentfernung zu gewährleisten. Laut Methoden für Saatgut und Sorten gem. § 5<br />
Saatgutgesetz werden natürliche Hindernisse zur Reduzierung des geforderten Mindestabstandes anerkannt,<br />
wenn sie in Hinblick auf Breite, Höhe und Dichtheit des Bewuchses einen angemessenen Schutz bilden um<br />
unerwünschten Fremdpolleneintrag zu verhindern. Die vorgeschriebene Entfernung kann um bis zu 100 m<br />
reduziert werden, wenn die Abschirmung eine Höhe von 6 m und eine Breite von zumindest 20 m erreicht.<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
www.ages.at<br />
Seite 135 von 154