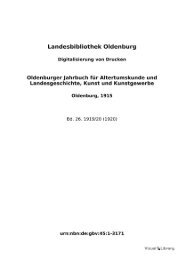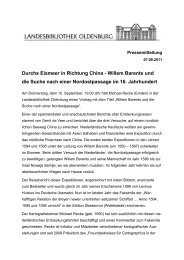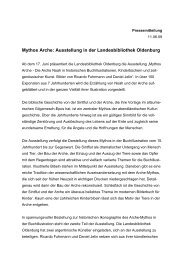Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hermann Lübbing<br />
noch ein Jahrzehnt hingezögert zu haben, bis eine neue W elle der Pestilenz<br />
über Europa hinwegrollte und diesmal noch größere Opfer forderte.<br />
In demUnglücksjahr 1350 klopfte der Knochenmann auch in W il<strong>des</strong>hausen<br />
an die Türen der Bürger und wütete grauenhaft. Die Stadt<br />
lag an der großen Vlämischen Straße, die den Frachtwagenverkehr<br />
der Hansischen Kaufleute zwischen Lübeck— Hamburg— Bremen einerseits<br />
und den Niederlanden andrerseits vermittelte. Tagaus lagein kam<br />
viel frem<strong>des</strong> Volk durch Wil<strong>des</strong>hausen gezogen, und bei den primitiven<br />
mittelalterlichen hygienischen Verhältnissen waren natürlich die V oraussetzungen<br />
<strong>für</strong> ein Umsichgreifen der Pest-Epidemie denkbar günstig.<br />
In dieser Zeit starben in Wil<strong>des</strong>hausen binnen drei Monaten 4000 Menschen.<br />
Die Krankheit dauerte nur drei Tage und endete regelmäßig mit<br />
dem Tode. Ein lähmen<strong>des</strong> Entsetzen befiel die Bevölkerung, und in<br />
dieser Not machte man sich eilends an den schon 1339 beschlossenen<br />
Kapellenbau.<br />
Über den Bau der Kapelle, deren Gestalt vielleicht der heute noch<br />
bestehenden Gertrudenkapelle in Oldenburg in etwa entsprochen haben<br />
wird, hat sich ein kurzer Bericht in Gedichtform erhalten, der dem<br />
Wil<strong>des</strong>hauser Amtmann Hinüber 1742 noch bekannt war1). Die handschriftliche<br />
Quelle galt als verschollen, fand sich aber kürzlich bei der<br />
Neuordnung von Archivalien <strong>des</strong> Staatsarchivs Oldenburg in Bestd. 109-D<br />
in einem Einkünfteregister der Propstei Wil<strong>des</strong>hausen von 1587— 1595.<br />
Aus der Einleitung zu dem Gedicht geht hervor, daß es sich ursprünglich<br />
um eine auf eine Holztafel (brede) geschriebene Aufzeichnung<br />
handelt. Vielleicht war es eine Votivtafel, mit einem Heiligenbild<br />
geschmückt und von einem Bürger gestiftet, der die Einzelheiten <strong>des</strong><br />
Kapellenbaus in Gedichtform festhielt und auf die Tafel malen ließ.<br />
Die Bau- und Kunstdenkmäler <strong>des</strong> Herzogtums Oldenburg I S. 115<br />
finden die Verse „nicht uninteressant", ihr Abdruck nach dem alten<br />
Register von 1595 ist daher wohl gerechtfertigt, zumal wir sonst wenig<br />
Erzeugnisse mittelalterlicher niederdeutscher Poesie besitzen. Die<br />
Sprachformen sind durchweg gut mittelniederdeutsch, nur gelegentlich<br />
machen sich hochdeutsche Einflüsse bemerkbar, die dem Schreiber <strong>des</strong><br />
Propsteiregisters zur Last fallen. Auch sind ihm vermutlich Lesefehler<br />
unterlaufen.<br />
•) In <strong>des</strong> Pastoren J. Vogt „Monumenta inedita" Bd. I 5, (Bremen 1742),<br />
S. 452. Der W ert der Hinüberschen Mitteilung „aus einem alten Register" ist<br />
von H. Oncken in den Bau-Kunstdenkm, d. Hzgts. Oldenburg 1, S. 37 sowie<br />
von G. Rüthning in seiner Oldenb. Gesch. Bd. 1 (1911), S. 101 etwas ange-<br />
zweifelt, und G. Sello erwähnt sie in seinem W il<strong>des</strong>hausen-Aufsatz (Alt-<br />
Oldenburg, 1903) überhaupt nicht.