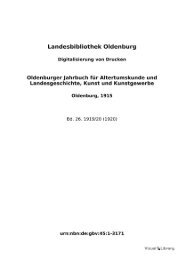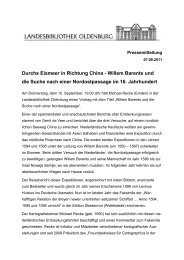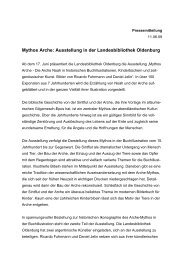Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Oldenburger Jahrbuch des Oldenburger Landesvereins für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
palen, und bleibt einmanualig; wir lassen sie einstweilen außer Betracht.)<br />
Das Pedalwerk der deutschen Renaissance wird selbständiges<br />
Einzelklavier zur Charakterisierung der Harmonie. Die Orgel von<br />
heute, wie sie der Laie kennt, steht in der Renaissanceorgel scheinbar<br />
fertig da, ihrem Wesen nach etwa orchestral mit den verschiedensten<br />
Klangfarben zum Zusammen- und Gegenspiel. Und tatsächlich liegt der<br />
Vergleich nahe: hier wie dort enge, solistisch verwendete Stimmen,<br />
die addiert und gemischt werden, aber sich nicht verschmelzen.<br />
Die Verschmelzungsunfähigkeit der Register der Renaissanceorgel<br />
(wie der meisten neueren Orgeln um 1900) liegt in ihrer engen Mensur<br />
begründet; weite Pfeifen mit schmalem Labium, niedrigem Aufschnitt<br />
und geringer Windzufuhr — wir nennen sie füllebetont —<br />
dagegen verschmelzen sich mit enggebauten Pfeifen — kraftbetont —<br />
und ergeben dann synthetisch einen überraschenden neuen Klang,<br />
enge Register allein lassen sich lediglich addieren und reagieren nur<br />
dynamisch, piano, mezzoforte, forte, fortissimo. Zu der engen Mensur<br />
der Renaissanceorgel kommt noch ihre Konstanz, d. h. das Verhältnis<br />
der Labienbreite zum Pfeifendurchmesser sämtlicher Pfeifen <strong>des</strong> Registers<br />
bleibt immer das gleiche, im Gegensatz zur variablen Mensur<br />
der nächsten Stilperiode, <strong>des</strong> Barock. Eine Orgel mit nur konstanten<br />
Mensuren klingt starr und langweilig und ermüdet Spieler wie Hörer<br />
(Tuttiorgel).<br />
Die Orgel der Renaissance beherrscht das 15. und 16. Jahrhundert,<br />
in der Spätrenaissance bereichert durch viele „Charakter'stimmen<br />
in Nachahmung von Orchesterinstrumenten. Die Orgelliteratur der<br />
damaligen Zeit spiegelt auch dieses Bild einer Renaissanceorgel getreulich<br />
wider in der linearen Zeichnung ihrer Polyphonie und ihren<br />
kunstvollen musikalischen Formen.<br />
Das Barockzeitalter, <strong>für</strong> das wir das 17. und die erste Hälfte <strong>des</strong><br />
18. Jahrhunderts ansetzen dürfen, setzt nun an die Stelle <strong>des</strong> vokalen<br />
Linearprinzips das instrumentale Chorprinzip, d. h. die einzelnen<br />
Instrumentenfamilien, vom Baß bis zum Diskant besetzt, spielen als<br />
Gruppen gegeneinander. Die Orgel der vorigen Stilperiode hatte vorgearbeitet,<br />
der Barock übernahm zum enggebauten Registerchor den<br />
weitgebauten der italienischen Renaissance (von deren Darstellung<br />
wir absahen), und — die Synthese zwischen den kraftbetonten R egisterfamilien<br />
<strong>des</strong> Nordens und den füllebetonten <strong>des</strong> Südens war gegeben.<br />
W ir ahnen, auch ohne Nennung bestimmter Registerbezeichnungen,<br />
den ungeheuren Fortschritt <strong>des</strong> Barock und nähern uns —<br />
Arp Schnitker! Was frühere Orgelbauer <strong>des</strong> Barock, etwa Hans<br />
Scherer d. Ä. und Gottfried Fritsche in der Bemessung ihrer Men-