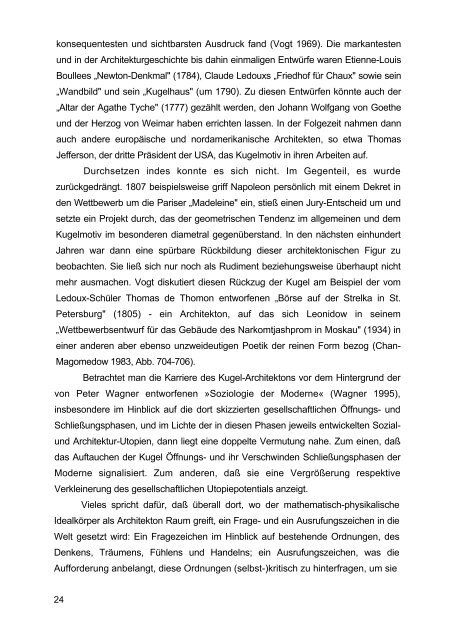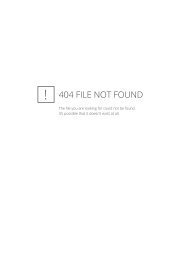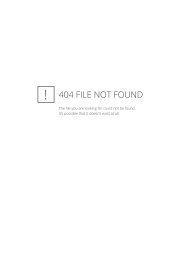Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
konsequentesten und sichtbarsten Ausdruck fand (Vogt 1969). <strong>Die</strong> markantesten<br />
und in der Architekturgeschichte bis dahin einmaligen Entwürfe waren Etienne-Louis<br />
Boullees „Newton-Denkmal" (1784), Claude Ledouxs „Friedhof für Chaux" sowie sein<br />
„Wandbild" und sein „<strong>Kugel</strong>haus" (um 1790). Zu diesen Entwürfen könnte auch der<br />
„Altar der Agathe Tyche" (1777) gezählt werden, den Johann Wolfgang von Goethe<br />
und der Herzog von Weimar haben errichten lassen. In der Folgezeit nahmen dann<br />
auch andere europäische und nordamerikanische Architekten, so etwa Thomas<br />
Jefferson, der dritte Präsident der USA, das <strong>Kugel</strong>motiv in ihren Arbeiten auf.<br />
Durchsetzen indes konnte es sich nicht. Im Gegenteil, es wurde<br />
zurückgedrängt. 1807 beispielsweise griff Napoleon persönlich mit einem Dekret in<br />
den Wettbewerb um die Pariser „Madeleine" ein, stieß einen Jury-Entscheid um und<br />
setzte ein Projekt durch, das der geometrischen Tendenz im allgemeinen und dem<br />
<strong>Kugel</strong>motiv im besonderen diametral gegenüberstand. In den nächsten einhundert<br />
Jahren war dann eine spürbare Rückbildung dieser architektonischen Figur zu<br />
beobachten. Sie ließ sich nur noch als Rudiment beziehungsweise überhaupt nicht<br />
mehr ausmachen. Vogt diskutiert diesen Rückzug der <strong>Kugel</strong> am Beispiel der vom<br />
Ledoux-Schüler Thomas de Thomon entworfenen „Börse auf der Strelka in St.<br />
Petersburg" (1805) - ein Architekton, auf das sich <strong>Leonidow</strong> in seinem<br />
„Wettbewerbsentwurf für das Gebäude des Narkomtjashprom in Moskau" (1934) in<br />
einer anderen aber ebenso unzweideutigen Poetik der reinen Form bezog (Chan-<br />
Magomedow 1983, Abb. 704-706).<br />
Betrachtet man die Karriere des <strong>Kugel</strong>-Architektons vor dem Hintergrund der<br />
von Peter Wagner entworfenen »Soziologie der Moderne« (Wagner 1995),<br />
insbesondere im Hinblick auf die dort skizzierten gesellschaftlichen Öffnungs- und<br />
Schließungsphasen, und im Lichte der in diesen Phasen jeweils entwickelten Sozial-<br />
und Architektur-Utopien, dann liegt eine doppelte Vermutung nahe. Zum einen, daß<br />
das Auftauchen der <strong>Kugel</strong> Öffnungs- und ihr Verschwinden Schließungsphasen der<br />
Moderne signalisiert. Zum anderen, daß sie eine Vergrößerung respektive<br />
Verkleinerung des gesellschaftlichen Utopiepotentials anzeigt.<br />
Vieles spricht dafür, daß überall dort, wo der mathematisch-physikalische<br />
Idealkörper als Architekton Raum greift, ein Frage- und ein Ausrufungszeichen in die<br />
Welt gesetzt wird: Ein Fragezeichen im Hinblick auf bestehende Ordnungen, des<br />
Denkens, Träumens, Fühlens und Handelns; ein Ausrufungszeichen, was die<br />
Aufforderung anbelangt, diese Ordnungen (selbst-)kritisch zu hinterfragen, um sie<br />
24