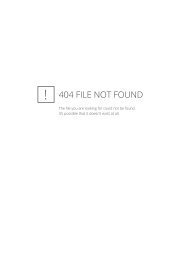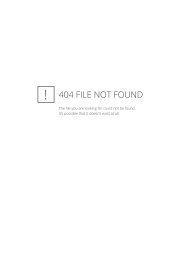Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutschlands weder begeistern noch begeisten, findet in Jacques Derridas Vortrag<br />
„Das andere Kap" (Derrida 1992) alternative Hauptstadtperspektiven. Derrida hielt<br />
diesen Vortrag am 20. Mai 1990 in Turin anläßlich eines Kolloquiums über die<br />
»kulturelle Identität Europas«. Für ihn stellte sein Diskussionsbeitrag „den Anfang<br />
einer vergleichenden Untersuchung dar, die Valérys, Husserls und Heideggers<br />
Diskurse über »die Krise oder die Entmachtung des Geistes als Krise oder<br />
Entmachtung des europäischen Geistes« zum Gegenstand hat" (ebd., S. 61).<br />
Der Begriff des »Kap«, um den er seine Überlegungen kreisen läßt,<br />
bezeichnet für Derrida Vielerlei, so etwa: einen Titel, den „Kopf eines Kapitels, ein<br />
Kopf im Sinne der Überschrift" (ebd., S. 15); „den Kopf, das Haupt, das äußerste<br />
Ende eines Außengliedes" (ebd.); „»faire cap« (»ansteuern, Kurs nehmen«)" oder<br />
„»changer de cap« (»den Kurs ändern«) (ebd.); Europa, als „ein »kleines<br />
[geographisches] Kap«, ein Ausläufer oder »Anhängsel« des »asiatischen<br />
Kontinents« und Körpers" (ebd., S. 20); oder „das Kapital (Marxens Werk und das<br />
Kapital im allgemeinen)" (ebd., S. 43). Und eben »Kap« im Sinne der Kapitale (ein<br />
anderes Wort für Hauptstadt)" (ebd., S. 30).<br />
Gleich zu Beginn seines Vortrages vertraut Derrida, der kein gebürtiger<br />
Europäer ist, seinen Zuhörern ein Gefühl und eine Erinnerung an, die auch seinen<br />
Hauptstadtperspektiven zugrundeliegen und die gerade vielen DDR-Bürgern sicher<br />
nicht ganz fremd sind. Er sagt, daß er sich mit zunehmenden Alter „immer mehr für<br />
eine Art über-kolonisierten Mischling hält, für einen Mischling, den eine übermäßige<br />
Akkulturation charakterisiert" (ebd., S. 10). „Vielleicht", meint Derrida, „ist es das<br />
Gefühl eines Menschen, der, seitdem er im französischen Algerien zur Schule ging,<br />
versuchen mußte, das hohe Alter Europas zu kapitalisieren und sich dabei zugleich<br />
etwas von der ungerührten und unempfindlichen Jugend des anderen Ufers, der<br />
anderen Seite zu bewahren" (ebd.).<br />
Und er schließt seine Rede mit einer Empfindung und einem Bekenntnis.<br />
Zweifellos sei er ein Europäer erklärt Derrida, „doch bin und fühle ich mich nicht<br />
durch und durch europäisch. Damit will ich sagen (mir liegt daran, ich muß es<br />
sagen), daß ich nicht durch und durch europäisch sein möchte und sein darf" (ebd.,<br />
S. 60). Derrida begründet dieses Empfinden mit einer Möglichkeit. Es sei machbar,<br />
mit einem Teil, und zwar „»mit einem ganzen Teil seiner selbst«", Europäer zu sein,<br />
ohne deshalb zwangsläufig „»durch und durch«" Europäer sein zu müssen (ebd.).<br />
88