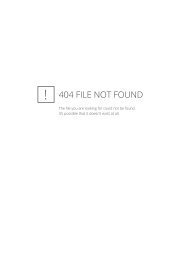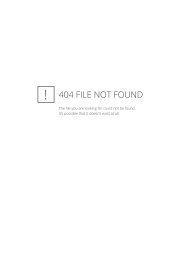Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Die Leonidow-Kugel. Zur technischen Paßfähigkeit moderner ... - WZB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dieser Vorstoß verursachte, war nicht nur erheblich und parteiübergreifend, er<br />
verband auch Protagonisten und Kritiker des Planwerkes.<br />
„Nun wächst zusammen, was zusammen gehört?" (Hain 1996, S. 8) war die<br />
analyseleitende Frage, die sich die Kunsthistorikerin Simone Hain bei ihrer<br />
grundsätzlichen Kritik und kategorischen Abweisung des Masterplanes stellte. Aber<br />
genau darauf ziele doch das Planwerk, erklärten seine geistigen Väter. Es ginge<br />
doch gerade darum, Berlin „zur Szene der Vereinigung" (Hoffman-Axthelm/Albers<br />
1996a, S. 6) zu machen und „nach der administrativen Vereinigung auch das<br />
mentale Zusammenwachsen Berlins voranzutreiben" (Strieder 1997). <strong>Die</strong>ses Ziel<br />
nicht nur verfehlt, sondern mit den Masterplanungen geradezu konterkariert zu<br />
haben, bescheinigte der Bau- und Verkehrssenator Jürgen Klemann (CDU) seinem<br />
SPD-Kollegen, indem er darauf verwies, daß dieser „völlig verkannt (habe), welche<br />
Empfindungen und Sensibilitäten gerade im Ostteil der Stadt ausgelöst werden,<br />
wenn man Planern, Architekten und Bürgern in dieser Weise mit einem solchen Plan<br />
zu nahe tritt" (Kleemann 1996). Mit seiner Auffassung, daß man damit das Planwerk<br />
zu einem „Schubladenprojekt" (Kleemann 1996) mache, stand Kleemann nicht allein.<br />
So meinte Sabine Ritter von den Bündnisgrünen, daß der Masterplan zum großen<br />
Teil „ein Ding fürs Klo" (zit. nach Lautenschläger 1997) sei und Thomas Flierl, der<br />
kulturpolitische Sprecher der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus, forderte<br />
„Stadtvertrag vor Planwerk" und rief dazu auf, „die kulturelle Einigung der Stadt<br />
diskursiv zu vollziehen" (Flierl Th. 1996). Für einen solchen Diskurs plädierte auch<br />
der Architekturtheoretiker Bruno Flierl, „damit wir als geteilte Stadt in die Zukunft<br />
hinein eine gemeinsame Identität suchen und finden" (Flierl B. 1996).<br />
Es war auffällig, daß sich in der ansonsten thematisch breit gefächerten und<br />
inhaltlich tief gestaffelten Planwerk-Debatte immer dann, wenn von „mentalem<br />
Zusammenwachsen", „Vereinigung" oder „kultureller Identitätsfindung" die Rede war,<br />
die Argumentationsperspektive rapide auf die deutsch/deutschen Befindlichkeiten<br />
verengte. <strong>Die</strong> Diskussion öffnete sich nur wenig und bei manchen Diskutanten<br />
überhaupt nicht den Ausländern, dem Ausland und dem Fremden. Auch die<br />
akademisch profiliertesten und politisch engagiertesten Wortmeldungen machten da<br />
keine Ausnahme. So referierte beispielsweise Simone Hain ausführlich Tourains<br />
„These von der 80:20 Ausgrenzung als möglichem neuen europäischen<br />
Gesellschaftsmodell" (Hain 1996, S. 9), was sie zum „Problem der Integration"<br />
führte, um es dann - alle in der Stadt lebenden Ausländer überspringend und nicht<br />
82