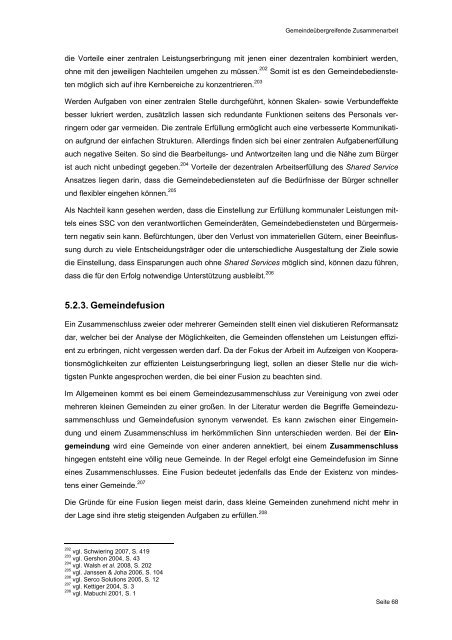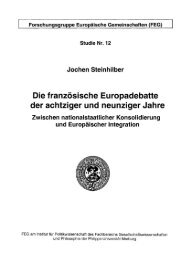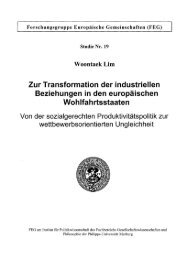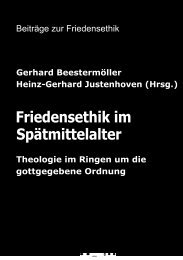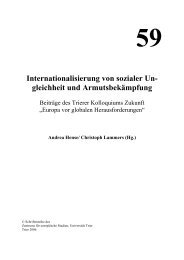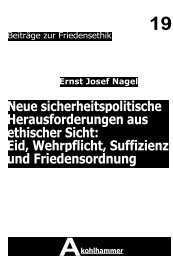Working Paper 2010 - Kommunales Haushaltsmanagement - eDoc
Working Paper 2010 - Kommunales Haushaltsmanagement - eDoc
Working Paper 2010 - Kommunales Haushaltsmanagement - eDoc
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit<br />
die Vorteile einer zentralen Leistungserbringung mit jenen einer dezentralen kombiniert werden,<br />
ohne mit den jeweiligen Nachteilen umgehen zu müssen. 202 Somit ist es den Gemeindebediensteten<br />
möglich sich auf ihre Kernbereiche zu konzentrieren. 203<br />
Werden Aufgaben von einer zentralen Stelle durchgeführt, können Skalen- sowie Verbundeffekte<br />
besser lukriert werden, zusätzlich lassen sich redundante Funktionen seitens des Personals verringern<br />
oder gar vermeiden. Die zentrale Erfüllung ermöglicht auch eine verbesserte Kommunikation<br />
aufgrund der einfachen Strukturen. Allerdings finden sich bei einer zentralen Aufgabenerfüllung<br />
auch negative Seiten. So sind die Bearbeitungs- und Antwortzeiten lang und die Nähe zum Bürger<br />
ist auch nicht unbedingt gegeben. 204 Vorteile der dezentralen Arbeitserfüllung des Shared Service<br />
Ansatzes liegen darin, dass die Gemeindebediensteten auf die Bedürfnisse der Bürger schneller<br />
und flexibler eingehen können. 205<br />
Als Nachteil kann gesehen werden, dass die Einstellung zur Erfüllung kommunaler Leistungen mittels<br />
eines SSC von den verantwortlichen Gemeinderäten, Gemeindebediensteten und Bürgermeistern<br />
negativ sein kann. Befürchtungen, über den Verlust von immateriellen Gütern, einer Beeinflussung<br />
durch zu viele Entscheidungsträger oder die unterschiedliche Ausgestaltung der Ziele sowie<br />
die Einstellung, dass Einsparungen auch ohne Shared Services möglich sind, können dazu führen,<br />
dass die für den Erfolg notwendige Unterstützung ausbleibt. 206<br />
5.2.3. Gemeindefusion<br />
Ein Zusammenschluss zweier oder mehrerer Gemeinden stellt einen viel diskutieren Reformansatz<br />
dar, welcher bei der Analyse der Möglichkeiten, die Gemeinden offenstehen um Leistungen effizient<br />
zu erbringen, nicht vergessen werden darf. Da der Fokus der Arbeit im Aufzeigen von Kooperationsmöglichkeiten<br />
zur effizienten Leistungserbringung liegt, sollen an dieser Stelle nur die wichtigsten<br />
Punkte angesprochen werden, die bei einer Fusion zu beachten sind.<br />
Im Allgemeinen kommt es bei einem Gemeindezusammenschluss zur Vereinigung von zwei oder<br />
mehreren kleinen Gemeinden zu einer großen. In der Literatur werden die Begriffe Gemeindezusammenschluss<br />
und Gemeindefusion synonym verwendet. Es kann zwischen einer Eingemeindung<br />
und einem Zusammenschluss im herkömmlichen Sinn unterschieden werden. Bei der Eingemeindung<br />
wird eine Gemeinde von einer anderen annektiert, bei einem Zusammenschluss<br />
hingegen entsteht eine völlig neue Gemeinde. In der Regel erfolgt eine Gemeindefusion im Sinne<br />
eines Zusammenschlusses. Eine Fusion bedeutet jedenfalls das Ende der Existenz von mindestens<br />
einer Gemeinde. 207<br />
Die Gründe für eine Fusion liegen meist darin, dass kleine Gemeinden zunehmend nicht mehr in<br />
der Lage sind ihre stetig steigenden Aufgaben zu erfüllen. 208<br />
202<br />
vgl. Schwiering 2007, S. 419<br />
203<br />
vgl. Gershon 2004, S. 43<br />
204<br />
vgl. Walsh et al. 2008, S. 202<br />
205<br />
vgl. Janssen & Joha 2006, S. 104<br />
206<br />
vgl. Serco Solutions 2005, S. 12<br />
207<br />
vgl. Kettiger 2004, S. 3<br />
208<br />
vgl. Mabuchi 2001, S. 1<br />
Seite 68