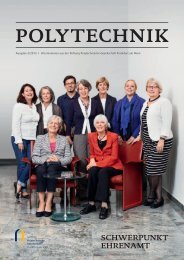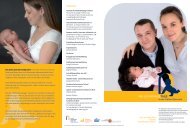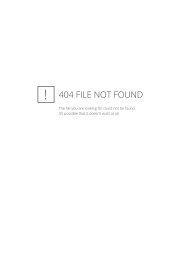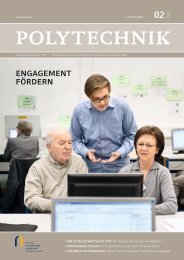Bürger, die Geschichte schreiben - Stiftung Polytechnische ...
Bürger, die Geschichte schreiben - Stiftung Polytechnische ...
Bürger, die Geschichte schreiben - Stiftung Polytechnische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
staDtteilHistoriker 2007 – 2010 | aNNa leiss (staDtteilÜBerGreiFeND) 63<br />
Neue Wasserleitung Frankfurt am Main, 1859. (Bild: ISG)<br />
<strong>die</strong> Frankfurter liberalen an sozialen Denkweisen. Die stadtväter verzichteten<br />
jahrelang auf <strong>die</strong> einführung von Wasseruhren, während<br />
in anderen deutschen städten <strong>die</strong>se abrechnungsform schon längst<br />
gang und gäbe war. Bis 1924 gab es einen Pauschaltarif, der im Frankfurter<br />
stadtgebiet zunächst bei vier Prozent des Mietwertes lag. Die<br />
Frankfurter stadtverordnetenversammlung ging noch einen schritt<br />
weiter. Vor allem ihre demokratischen Vertreter forderten eine Befreiungsgrenze<br />
für arme und bedürftige einwohner. schon vor 1889 hatte<br />
<strong>die</strong> stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Wasserpreis für<br />
günstige Wohnungen zu senken. auf Drängen des Magistrats hatte<br />
sie den Beschluss jedoch wieder fallenlassen. erst als <strong>die</strong> Wasserversorgung<br />
offensichtlich Gewinne abwarf, kamen <strong>die</strong> stadtvertreter<br />
überein, dass es „ein Gebot der logik und der Gerechtigkeit“ sei,<br />
neben steuersenkungen auch das Wassergeld für bedürftige Bewohner<br />
zu reduzieren.<br />
am 1. april 1889 trat schließlich das neue ortsstatut in kraft, nach<br />
dem alle Mieter, <strong>die</strong> einen jährlichen Mietwert bis zu 250 Mark hatten,<br />
von der Wassergeldzahlung befreit wurden.<br />
Dies gewährleistete, dass konsumenten unabhängig von ihrer<br />
sozialen stellung nicht nur eine ausreichende Wassermenge für<br />
hygienische Zwecke überhaupt zur Verfügung hatten, sondern Wasser<br />
auch nach den persönlichen Bedürfnissen verbrauchen konnten.<br />
Die Diskussionen über einen angemessenen Wasserpreis sind in<br />
Frankfurt bis heute nicht abgebrochen. 2007 strengte das hessische<br />
Wirtschaftsministerium ein kartellverfahren gegen den Frankfurter<br />
Wasseranbieter Mainova wegen vermeintlich missbräuchlich hoher<br />
Wasserpreise an. Das Gerichtsurteil ist bis heute nicht gefällt. anders<br />
sieht es bei der Frankfurter stadtentwässerung aus: <strong>die</strong> satzung des<br />
städtischen eigenbetriebes verlangt noch heute moderate Preise für<br />
<strong>die</strong> Benutzung der kanalisation.<br />
als 1894 <strong>die</strong> stadtverordneten erstmals über eine Benutzungsgebühr<br />
für <strong>die</strong> kanalisation sprachen, argumentierten einzelne städtische<br />
Vertreter, dass eine Gebühr nur einzuführen sei, wenn der kanalbetrieb<br />
ein Haushaltsdefizit aufweise. ein Fünftel des städtischen<br />
Haushaltes floss damals jährlich in den kanalbau. Die ausgaben der<br />
ZUr PersoN<br />
Anna Leiss<br />
anna leiss, geboren 1981 in der Hansestadt<br />
Hamburg, wuchs im Großraum Frankfurt<br />
auf und lebt heute im beschaulichen<br />
Dietesheim, einem ortsteil von Mühlheim<br />
am Main.<br />
sie hat bis 2009 an der Goethe-Universität<br />
Mittlere und Neuere <strong>Geschichte</strong> sowie<br />
Politikwissenschaften stu<strong>die</strong>rt. in ihrer abschlussarbeit<br />
beschäftigte sich leiss erstmals<br />
mit dem thema „Munizipalsozialismus<br />
in Frankfurt? Das entstehen der städtischen<br />
leistungsverwaltung.“ in akten aus dem<br />
institut für stadtgeschichte stieß sie dabei<br />
auf eine bisher kaum beachtete Besonderheit<br />
Frankfurts: eine soziale tarifgestaltung<br />
in der Wasserver- und -entsorgung. im<br />
Programm „stadtteilHistoriker“ konnte sie<br />
<strong>die</strong> Forschungen zu <strong>die</strong>sem thema weiter<br />
ausbauen und durch Veröffentlichungen<br />
und in Vorträgen einem größeren Publikum<br />
vorstellen.<br />
aktuell arbeitet leiss an ihrer von dem<br />
Frankfurter Professor andreas Fahrmeir<br />
betreuten Dissertation, <strong>die</strong> thematisch eine<br />
Weiterführung ihrer abschlussarbeit ist.<br />
neuen städtetechnik belasteten den Haushalt so stark, dass Frankfurt<br />
kredite aufnehmen musste. 1904 ließ sich aufgrund <strong>die</strong>ser<br />
kosten eine Gebühr nicht mehr vermeiden. Um auch <strong>die</strong>se Gebühren<br />
sozialverträglich zu gestalten, staffelte sich der Betrag ähnlich<br />
dem Wasserpreis und orientierte sich am Mietwert der immobilie.<br />
Bewohner mit einem jährlichen Mietzins von weniger als 300<br />
Mark blieben von der Gebühr gänzlich befreit. Die einführung der<br />
Befreiungs grenze zeigt, dass soziale Gesichtspunkte bei der Gebührenerhebung<br />
eine wichtige rolle spielten – und Frankfurt einen<br />
durchaus sozialen Weg in <strong>die</strong> Moderne gewählt hat.