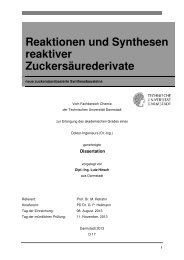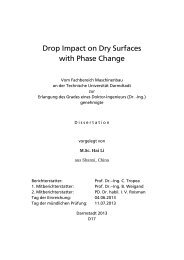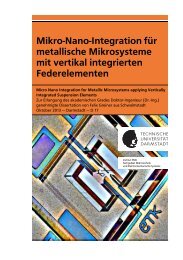Einsatz von Metalloxid-Varistoren zum Überspannungsschutz ...
Einsatz von Metalloxid-Varistoren zum Überspannungsschutz ...
Einsatz von Metalloxid-Varistoren zum Überspannungsschutz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9 Regeln zur Dimensionierung eines vollständigen Schutzkonzeptes mit <strong>Varistoren</strong> Seite 143<br />
In den Beispielrechnungen wurden die Verlustleistungen bzw. Kühlkörperdimensionen<br />
pro Varistor angegeben. Im fertigen Produkt werden die drei <strong>Varistoren</strong> aus<br />
Platzgründen aber sehr nahe beieinander angeordnet sein, so dass sich die einzelnen<br />
Kühlkörper gegenseitig in ihrer Kühlleistung beeinflussen werden, was an dieser Stelle<br />
nicht berücksichtigt wurde. Darüber hinaus zeigt sich hier, dass die Pulsfrequenz des<br />
Antriebssystems der am stärksten einschränkende Parameter in Bezug auf<br />
Realisierbarkeit des Schutzkonzeptes ist.<br />
In den Beispielen wurde eine Pulsfrequenz <strong>von</strong> fP = 3 kHz angenommen, was für<br />
Antriebe kleiner Leistung eher eine Untergrenze darstellt. In der Regel sind bei<br />
Antriebsleistungen bis ca. 20 kW Pulsfrequenzen <strong>von</strong> bis zu 20 kHz realisierbar. Da<br />
aber die Verlustleistung in den <strong>Varistoren</strong> linear mit der Pulsfrequenz steigt, wird der<br />
Kühlaufwand bei höheren Pulsfrequenzen immens und nicht mehr umsetzbar. U. a.<br />
aus diesem Grund wird empfohlen, das Schutzkonzept in Antriebssystemen größerer<br />
Leistung umzusetzen, da hier die Pulsfrequenzen deutlich kleiner sind und so der<br />
Kühlaufwand vergleichbar gering bleibt. Außerdem wird die Verlustleistung der<br />
<strong>Varistoren</strong> in die Energiebilanz des Antriebssystems mit eingerechnet – lässt man<br />
maximal 1 ‰ zusätzliche Verluste durch die <strong>Varistoren</strong> zu, so wäre ein <strong>Einsatz</strong> bei ca.<br />
100 W Varistorverlustleistung erst ab 100 kW Antriebsleistung realistisch.<br />
9.4 Auswahl und Dimensionierung der Sicherungen<br />
In Kap. 8.2.6 wurde auf das Ausfallverhalten der <strong>Varistoren</strong> in der angesprochenen<br />
Anwendung eingegangen. Hier stellte sich heraus, dass die <strong>Varistoren</strong> in jedem Fall als<br />
Kurzschluss in Folge eines Randüberschlages oder eines Durchschlages ausfallen, so<br />
dass der Antrieb nach Ausfall nur eines Varistors wegen Überstroms abschalten<br />
würde. Normalerweise stellen die Überspannungen in Folge <strong>von</strong> Wanderwellen nur im<br />
Langzeitbetrieb eine Gefahr für die Wicklungsisolation dar, so dass nach Ausfall des<br />
<strong>Überspannungsschutz</strong>es eigentlich kein Anlass zur sofortigen Abschaltung des<br />
Antriebes besteht. Daher wird hier die Möglichkeit gezeigt, durch <strong>Einsatz</strong> einer<br />
Schmelzsicherung den ausgefallenen Varistor vom Antriebssystem zu trennen und so<br />
die Maschine ohne <strong>Überspannungsschutz</strong> in der betroffenen Phase unterbrechungsfrei<br />
weiterbetreiben zu können, bis sich die Möglichkeit ergibt, den defekten Varistor zu<br />
wechseln. Dementsprechend wird die Prinzipschaltung der <strong>Varistoren</strong> zwischen Phase<br />
und Erde aus Abb. 6.1 um jeweils eine Schmelzsicherung pro Phase nach Abb. 9.3<br />
erweitert, wobei die Sicherung möglichst auf die Hochpotentialseite des Varistors<br />
geschaltet werden sollte, um sogar den Wechsel eines defekten Varistors im laufenden<br />
Betrieb zu ermöglichen.