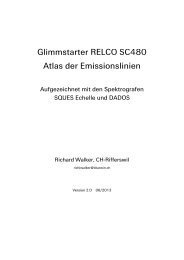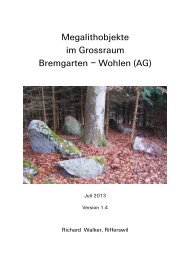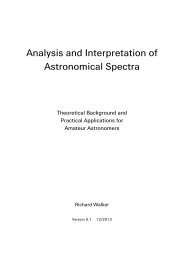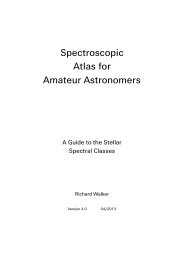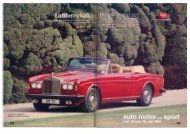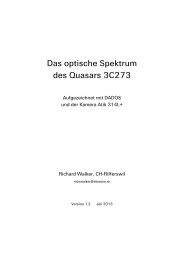Beitrag zur Astrospektroskopie 8.7 - UrsusMajor
Beitrag zur Astrospektroskopie 8.7 - UrsusMajor
Beitrag zur Astrospektroskopie 8.7 - UrsusMajor
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Beitrag</strong> <strong>zur</strong> Spektroskopie für Amateurastronomen 28<br />
8 Kalibrierung und Normierung von Spektren<br />
8.1 Die Kalibrierung der Wellenlänge<br />
Spektren werden normalerweise als Intensitätsverlauf der Strahlung über die Wellenlänge<br />
aufgetragen. Grundsätzlich können beide Dimensionen kalibriert werden. Für die meisten<br />
Anwendungen ist nur die Kalibrierung der Wellenlänge erforderlich. Dies kann relativ einfach<br />
mit bekannten Spektrallinien im Spektrum oder auch absolut mit geeigneten Eichlichtquellen<br />
durchgeführt werden. Diese Verfahren sind in der Literatur ausführlich dokumentiert<br />
z.B. [30], [411]. Weitere Infos siehe auch Kap. 15.<br />
8.2 Die selektive Dämpfung der Kontinuumsintensität<br />
Der Intensitätsverlauf des ungestörten, stellaren Originalspektrums wird hauptsächlich<br />
von der Schwarzkörper-Strahlungscharakterisik des Sterns und dessen Effektivtemperatur<br />
bestimmt (Kap. 3.2). Folgende Dämpfungseinflüsse deformieren auf dessen<br />
langem Weg zum aufgezeichneten, unbearbeiteten Rohprofil mit dem Pseudokontinuum<br />
.<br />
1. Die Dämpfung durch die Interstellare Materie wird vorwiegend durch Streueffekte<br />
an Staubkörnern und Gas verursacht. Dadurch wird die Intensität selektiv, d.h. im<br />
kurzwelligen, blauen Teil des Spektrums wesentlich stärker reduziert. Der Schwerpunkt der<br />
Kontinuumsstrahlung verschiebt sich so in Richtung des langwelligen Rotbereichs, was als<br />
interstellare Extinktion oder „Interstellar Reddening“ (Kap. 21) bezeichnet wird. Das Ausmass<br />
dieses Effektes ist abhängig von der Objektdistanz, der Richtung des Sehstrahls und<br />
in der galaktischen Ebene erwartungsgemäss am grössten. Es kann mit einem entsprechenden<br />
3D Modell nach F. Arenou et al. [209], [201], grob abgeschätzt werden.<br />
2. Die Dämpfung in der Erdatmosphäre wirkt ähnlich. Allgemein bekannte Effekte<br />
sind die orange/roten Sonnenuntergänge. Die Modellierung dieser Dämpfung wird hauptsächlich<br />
im professionellen Bereich angewendet, ist relativ komplex und hängt u.a. vom<br />
Zenitabstand (oder komplementär vom Elevationswinkel) des beobachteten Objektes, der<br />
Höhenlage des Beobachtungsplatzes und den meteorologischen Bedingungen ab [303].<br />
3. Die Dämpfung durch instrumentelle Einflüsse des Systems Teleskop-<br />
Spektrograf-Kamera, erfolgt noch zum Abschluss. Diese kann relativ genau bestimmt werden,<br />
z.B. mit der bekannten Strahlungsverteilung einer Halogen Glühlampe. Eine detaillierte<br />
Diskussion weiterer Möglichkeiten und der damit verbundenen Schwierigkeiten, siehe<br />
[315], [316].<br />
Der gesamte Dämpfungseinfluss beträgt<br />
Die empirische Dämpfungsfunktion liefert zu jeder beliebigen Wellenlänge den<br />
Korrekturfaktor zwischen Kontinuumsintensität und<br />
lässt sich nur als Näherung bestimmen weil der Intensitätsverlauf des stellaren Originalspektrums<br />
nur auf theoretischer Basis simuliert und die einzelnen Faktoren nur näherungsweise<br />
bestimmt oder abgeschätzt werden können. Ähnliche Ansätze mit empirischen<br />
Funktionen können auch in [300] und [303] gefunden werden. Das praktische Rechnen mit<br />
Profilen ermöglicht – mit allen Grundoperationen – die Software der Auswertetools für<br />
Spektralprofile. Bei Vspec ist diese Funktion unter Operations/Divide-, Multiply-, Add-, Subtract<br />
Profile by a Profile zu finden.