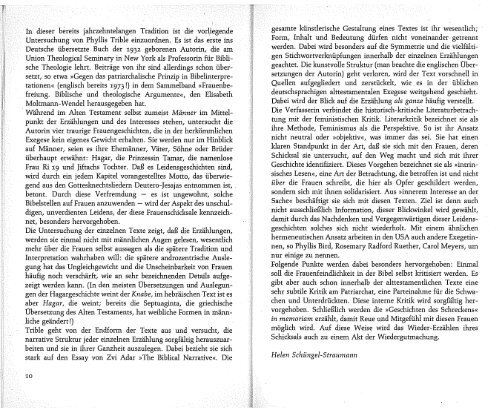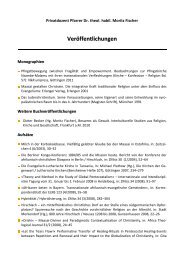Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ereits jahrzehntelangen Tradition ist die vOJrliegellde<br />
Untersuchung von Phyllis <strong>Trible</strong> einzuordnen. Es ist das erste ins<br />
Deutsche übersetzte Buch der 1932 geborenen Autorin, die am<br />
Union Theological Seminary in New York als Professorin für Biblische<br />
Theologie lehrt. Beiträge von ihr sind allerdings schon übersetzt,<br />
so etwa »Gegen das patriarchalische Prinzip in Bibelinterpretationen«<br />
(englisch bereits 19731) in dem Sammelband »Frauenbefreiung.<br />
Biblische und theologische Argumente«, den Elisabeth<br />
Moltmann-Wendel herausgegeben hat.<br />
. Während im Alten Testament selbst zumeist Männer im Mittelpunkt<br />
der Erzählungen und des Interesses stehen, untersucht die<br />
Autorin vier traurige Frauengeschichten, die in der herkömmlichen<br />
Exegese kein eigenes Gewicht erhalten. Sie werden nur im Hinblick<br />
auf Männer, seien es ihre Ehemänner, Väter, Söhne oder Brüder<br />
überhaupt erwähnt: Hagar, die Prinzessin Tamar, die namenlose<br />
Frau Ri 19 und Jiftachs Tochter. Daß es Leidensgeschichten sind,<br />
wird durch ein jedem Kapitel vorangestelltes Motto, das überwiegend<br />
aus den Gottesknechtsliedern Deutero-Jesajas entnommen ist, .<br />
betont. Durch diese Verfremdung - es ist ungewohnt, solche<br />
Bibelstellen auf Frauen anzuwenden - wird der Aspekt des unschuldigen,<br />
unverdienten Leidens, der diese Frauenschicksale kennzeichnet,<br />
besonders hervorgehoben.<br />
Die Untersuchung der einzelnen Texte zeigt, daß die Erzählungen,<br />
werden sie einmal nicht mit männlichen Augen gelesen, wesentlich<br />
mehr über die Frauen selbst aussagen als die spätere Tradition und<br />
Interpretation wahrhaben will: die spätere androzentrische Auslegung<br />
hat das Ungleichgewicht und die Unscheinbarkeit von Frauen<br />
häufig noch verschärft, wie an sehr bezeichnenden Details aufgezeigt<br />
werden kann. (In den meisten Übersetzungen und Auslegungen<br />
der Hagargeschichte weint der Knabe, im hebräischen Text ist es<br />
aber Hagar, die weint; bereits die Septuaginta, die griechische<br />
Übersetzung des Alten Testaments, hat weibliche Formen in männliche<br />
geändert!)<br />
<strong>Trible</strong> geht von der Endform der Texte aus und versucht<br />
narrative Struktur jeder einzelnen Erzählung s~rgfältig heraus~uarbeiten<br />
und sie in ihrer Ganzheit auszulegen. Dabei bezieht sie sich<br />
stark auf den Essay von Zvi Adar »The Biblical Narrative«. Die<br />
die<br />
ge:5aIJrrte künstlerische Gestaltung eines Textes ist ihr wesentlich;<br />
Form, Inhalt und Bedeutung dürfen nicht voneinander getrennt<br />
werden. Dabei wird besonders auf die Symmetrie und die vielfältigen<br />
Stichwortverknüpfungen innerhalb der einzelnen Erzählungen<br />
geachtet. Die kunstvolle Struktur (man beachte die englischen Übersetzungen<br />
der Autorin) geht verloren, wird der Text vorschnell in<br />
Quellen aufgegliedert und zerstückelt, wie es in der üblichen<br />
deutschsprachigen alttestamentalen Exegese weitgehend geschieht.<br />
Dabei wird der Blick auf die Erzählung als ganze häufig verstellt.<br />
Die Verfasserin verbindet die historisch-kritische Literaturbetrachtung<br />
mit der feministischen Kritik. Literarkritik bezeichnet sie als<br />
ihre Methode, Feminismus als die Perspektive. So ist ihr Ansatz<br />
nicht neutral oder »objektiv«, was inlmer das sei. Sie hat einen<br />
klaren Standpunkt in der Art, daß sie sich mit den Frauen, deren<br />
Schicksal sie untersucht, auf den Weg macht und sich mit ihrer<br />
Geschichte identifiziert. Dieses Vorgehen bezeichnet sie als »intrinsisches<br />
Lesen«, eine Art der Betrachtung, die betroffen ist und nicht<br />
über die Frauen schreibt, die hier als Opfer geschildert werden,<br />
sondern sich mit ihnen solidarisiert. Aus »innerem Interesse an der<br />
Sache« beschäftigt sie sich mit diesen Texten. Ziel ist denn auch<br />
nicht ausschließlich Information, dieser Blickwinkel wird gewählt,<br />
danrrit durch das Nachdenken und Vergegenwärtigen dieser Leidensgeschichten<br />
solches sich nicht wiederholt. Mit einem ähnlichen<br />
hermeneutischen Ansatz arbeiten in den USA auch andere Exegetinnen,<br />
so Phyllis Bird, Rosemary Radford Ruether, Carol Meyers, um<br />
nur einige zu nennen.<br />
Folgende Punkte werden dabei besonders hervorgehoben: Einmal<br />
soll die Frauenfeindlichkeit in der Bibel selbst kiitisiert werden. Es<br />
gibt aber auch schon innerhalb der alttestamentlichen Texte eine<br />
sehr subtile Kritik am Patriarchat, eine Parteinahme rur die Schwachen<br />
und Unterdrückten. Diese interne Kritik wird sorgfältig hervorgehoben.<br />
Schließlich werden die »Geschichten des Schreckens«<br />
in memoriam erzählt, danrrit Reue und Mitgefühl mit diesen Frauen<br />
möglich wird. Auf diese Weise wird das Wieder-Erzählen ihres<br />
Schicksals auch zu einem Akt der Wiedergutmachung.<br />
Helen Schüngel-Straumann<br />
10