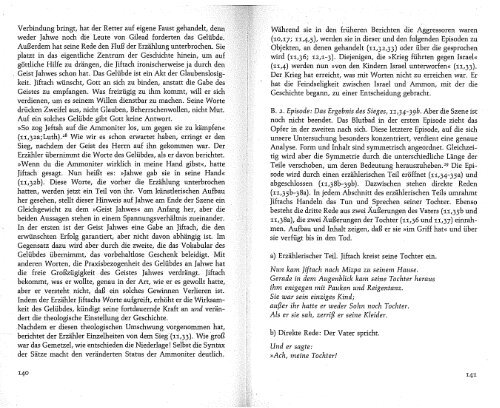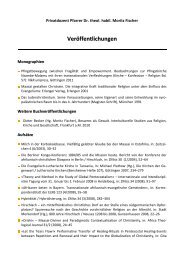Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Verbindung bringt, hat der Retter auf eigene Faust gehandelt,<br />
weder Jahwe noch die Leute von Gilead forderten das r' -, •• , ,<br />
Außerdem hat seine Rede den Fluß der Erzählung unterbrochen.<br />
platzt in das eigentliche Zentrum der Geschichte hinein, um<br />
göttliche Hilfe zu drängen, die Jiftach ironischerweise durch<br />
Geist Jahwes schon hat. Das Gelübde ist ein Akt der Glcluben!,lmiigkeit.<br />
Jiftach wünscht, Gott an sich zu binden, anstatt die Gabe<br />
Geistes zu empfangen. Was freizügig zu ihm kommt, will er<br />
verdienen, um es seinem Willen dienstbar zumachen. Seine Worte<br />
drücken Zweifel aus, nicht Glauben, Beherrschenwollen, nicht Mut.<br />
Auf ein solches Gelübde gibt Gott keine Antwort.<br />
»So zog Jeftah auf die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen«<br />
(11.,]2a; Luth). 28 Wie wir es schon er<strong>war</strong>tet haben, erringt er den<br />
Sieg, nachdem der Geist des Herrn auf ihn gekommen <strong>war</strong>. Der<br />
Erzähler übernimmt die Worte des Gelübdes, als er davon berichtet.<br />
»Wenn du die Ammoniter wirklich in <strong>mein</strong>e Hand gibst«, hatte<br />
Jiftach gesagt. Nun heißt es: »Jahwe gab sie in seine Hand«<br />
(1.1.,J2b). Diese Worte, die vorher die Erzählung unterbrochen<br />
hatten, werden jetzt ein Teil von ihr. Vom künstlerischen Aufbau<br />
her gesehen, stellt dieser Hinweis auf Jahwe am Ende der Szene ein<br />
Gleichgewicht zu dem »Geist Jahwes« am Anfang her, aber die<br />
beiden Aussagen stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander.<br />
In der ersten ist der Geist Jahwes eine Gabe an Jiftach, die den<br />
erwünschten Erfolg garantiert, aber nicht davon abhängig ist. Im<br />
Gegensatz dazu wird aber durch die zweite, die das Vokabular des<br />
Gelübdes übernimmt, das vorbehaltlose Geschenk beleidigt. Mit<br />
anderen Worten, die Praxisbezogenheit des Gelübdes an Jahwe hat<br />
die freie Großzügigkeit des Geistes Jahwes verdrängt. Jiftach<br />
bekommt, was er wollte, genau in der Art, wie er es gewollt hatte,<br />
aber er versteht nicht, daß ein solches Gewinnen Verlieren ist.<br />
Indem der Erzähler Jiftachs Worte aufgreift, erhöht er die Wirksamkeit<br />
des Gelübdes, kündigt seine fortdauernde Kraft an und verändert<br />
die theologische Einstellung der Geschichte.<br />
Nachdem er diesen theologischen Umschwung vorgenommen hat,<br />
berichtet der Erzähler Einzelheiten von dem Sieg (11.,]3). Wie groß<br />
<strong>war</strong> das Gemetzel, wie entschieden die Niederlage! Selbst die Syntax<br />
der Sätze macht den veränderten Status der Ammoniter deutlich.<br />
Wählrenld sie in den früheren Berichten die Aggressoren <strong>war</strong>en<br />
11.,4,S), werden sie in dieser und den folgenden Episoden zu<br />
Objeklten, an denen gehandelt (11.,32,]3) oder über die gesprochen<br />
(11.,]6; 1.2,1.-3). Diejenigen, die »Krieg führten gegen Israel«<br />
werden nun »von den Kindern Israel unterworfen« (11.,]3).<br />
Krieg hat erreicht, was mit Worten nicht zu erreichen <strong>war</strong>. Er<br />
die Feindseligkeit zwischen Israel und Ammon, mit der die<br />
Geschichte begann, zu einer Entscheidung gebracht.<br />
B. 2. Episode: Das Ergebnis des Sieges, 1I,34-39b. Aber die Szene ist<br />
noch nicht beendet. Das Blutbad in der ersten Episode zieht das<br />
Opfer in der zweiten nach sich. Diese letztere Episode, auf die sich<br />
unsere Untersuchung besonders konzentriert, verdient eine genaue<br />
Analyse. Form und Inhalt sind symmetrisch angeordnet. Gleichzeitig<br />
wird aber die Symmetrie durch die unterschiedliche Länge der<br />
Teile verschoben, um deren Bedeutung herauszuheben. 29 Die Episode<br />
wird durch einen erzählerischen Teil eröffnet (11.']4-3Sa) und<br />
abgeschlossen (11.,]8b-39b). Dazwischen stehen direkte Reden<br />
(11.,]Sb-38a). In jedem Abschnitt des erzählerischen Teils umrahmt<br />
Jiftachs Handeln das Tun und Sprechen seiner Tochter. Ebenso<br />
besteht die dritte Rede aus zwei Äußerungen des Vaters (11.,)Sb und<br />
11.,]8a), die zwei Äußerungen der Tochter (11.,)6 und 11.,]7) einrahmen.<br />
Aufbau und Inhalt zeigen, daß er sie »im Griff hat« und über<br />
sie verfügt bis in den Tod.<br />
a) Erzählerischer Teil. Jiftach kreist seine Tochter ein.<br />
Nun kam li/tach nach Mizpa zu seinem Hause.<br />
Gerade in dem Augenblick kam seine Tochter heraus<br />
ihm entgegen mit Pauken und Reigentanz.<br />
Sie <strong>war</strong> sein einziges Kind;<br />
außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter.<br />
Als er sie sah, zerriß er seine Kleider.<br />
b) Direkte Rede: Der Vater spricht.<br />
Und er sagte:<br />
»Ach, <strong>mein</strong>e Tochter!