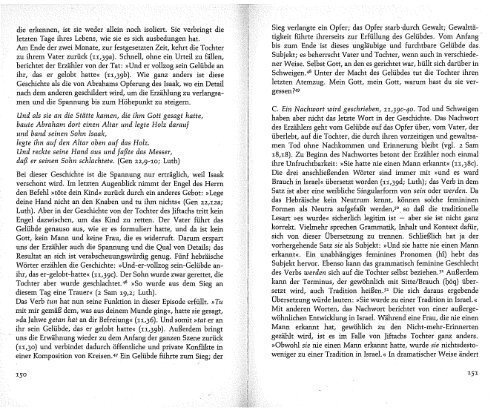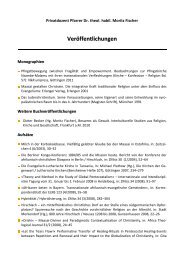Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ed.enneltl, ist sie weder allein noch isoliert. Sie verbringt die<br />
letzten Tage ihres Lebens, wie sie es sich ausbedungen hat.<br />
Am Ende der zwei Monate, zur festgesetzten Zeit, kehrt die Tochter<br />
zu ihrem Vater zurück (:11')9a). Schnell, ohne ein Urteil zu fällen,<br />
berichtet der Erzähler von der Tat: »Und er vollzog sein Gelübde an<br />
ihr, das er gelobt hatte« (:11,39b). Wie ganz anders ist diese<br />
Geschichte als die von Abrahams Opferung des Isaak, wo ein Detail<br />
nach dem anderen geschildert wird; um die Erzählung zu verlangsamen<br />
und die Spannung bis zum Höhepunkt zu steigern.<br />
Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte,<br />
baute Abraham dort einen Altar und legte Holz darauf<br />
und band seinen Sohn Isaak, .<br />
legte ihn auf den Altar oben auf das Holz.<br />
Und reckte seine Hand aus und faßte das Messer,<br />
daß er seinen Sohn schlachtete. (Gen 228-10; Luth)<br />
Bei dieser Geschichte ist die Spannung nur erträglich, weil Isaak<br />
verschont wird. Im letzten Augenblick nimmt der Engel des Herrn<br />
den Befehl »töte dein Kind« zurück durch ein anderes Gebot: »Lege<br />
deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts« (Gen 22,12a;<br />
Luth). Aber in der Geschichte von der Tochter des Jiftachs tritt kein<br />
Engel dazwischen, um das Kind zu retten. Der Vater führt das<br />
Gelübde genauso aus, wie er es formuliert hatte, und da ist kein<br />
Gott, kein Mann und keine Frau, die es widerruft. Darum erspart<br />
uns der Erzähler auch die Spannung und die Qual von Details; das<br />
Resultat an sich ist verabscheuungswürdig genug. Fünf hebräische<br />
Wörter erzählen die Geschichte: »Und-er-vollzog sein-Gelübde anihr,<br />
das er-gelabt-hatte« (:11')9C). Der Sohn wurde z<strong>war</strong> gerettet, die<br />
Tochter aber wurde geschlachtet. 46 »So wurd·e aus dem Sieg an<br />
diesem Tag eine Trauer« (2 Sam 19,2; Luth).<br />
Das Verb tun hat nun seine Funktion in dieser Episode erfüllt. »Tu<br />
mit mir gemäß dem, was aus deinem Munde ging«, hatte sie gesagt,<br />
»da Jahwe getan hat an dir Befreiung« (:11,)6). Und somit »tat er an<br />
ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte« (:11')9b). Außerdem bringt<br />
uns die Erwähnung wieder zu dem Anfang der ganzen Szene zurück<br />
(:11,)0) und verbindet dadurch öffentliche und private Konflikte in<br />
einer Komposition von Kreisen. 47 Ein Gelübde führte zum Sieg; der<br />
Sieg verlangte ein Opfer; das Opfer starb -durch Gewalt; Gewalttätigkeit<br />
führte ihrerseits zur Erfüllung des Gelübdes. Vom Anfang<br />
bis zum Ende ist dieses ungläubige und furchtbare Gelübde das<br />
Subjekt; es beherrscht Vater und Tochter, wenn auch in verschiedener<br />
Weise. Selbst Gott, an den es gerichtet <strong>war</strong>, hüllt sich darüber in<br />
Schweigen. 48 Unter der Macht des Gelübdes tut die Tochter ihren<br />
letzten Atemzug. Mein Gott, <strong>mein</strong> Gott, <strong>war</strong>um hast du sie vergessen?49<br />
C. Ein Nachwort wird geschrieben, 11,]9C-40. Tod und Schweigen<br />
haben aber nicht das letzte Wort in der Geschichte. Das Nachwort<br />
des Erzählers geht vom Gelübde auf das Opfer über, vom Vater, der<br />
überlebt, auf die Tochter, die durch ihren vorzeitigen und gewaltsamen<br />
Tod ohne Nachkommen und Erinnerung bleibt (vgL 2 Sam<br />
18,18). Zu Beginn des Nachwortes betont der Erzähler noch einmal<br />
ihre Unfruchtbarkeit: »Sie hatte nie einen Mann erkannt« (11,)8c).<br />
Die drei anschließenden Wörter sind immer mit »und es <strong>war</strong>d<br />
Brauch in Israel« übersetzt worden (:11,39d; Luth); das Verb in dem<br />
Satz ist aber eine weibliche Singularform von sein oder werden. Da<br />
das Hebräische kein Neutrum kennt, können solche femininen<br />
Formen als Neutra aufgefaßt werden,5 0 so daß die traditionelle<br />
Lesart »es wurde« sicherlich legitim ist - aber sie ist nicht ganz<br />
korrekt. Vielmehr sprechen Grammatik, Inhalt und Kontext dafür,<br />
sich von dieser Übersetzung zu trennen. Schließlich hat ja der<br />
vorhergehende Satz sie als Subjekt: »Und sie hatte nie einen Mann<br />
erkannt«. Ein unabhängiges feminines Pronomen (hl) hebt das<br />
Subjekt hervor. Ebenso kann das grammatisch feminine Geschlecht<br />
des Verbs werden sich auf die Tochter selbst beziehenY Außerdem<br />
kann der Terminus, der gewöhnlich mit Sitte/Brauch (Mq) übersetzt<br />
wird, auch Tradition heißenY Die sich daraus ergebende<br />
Übersetzung würde lauten: »Sie wurde zu einer Tradition in IsraeL«<br />
Mit anderen Worten, das Nachwort berichtet von einer außergewöhnlichen<br />
Entwicklung in IsraeL Während eine Frau, die nie einen<br />
Mann erkannt hat, gewöhlich zu den Nicht-mehr-Erinnerten<br />
gezählt wird, ist es im Falle von Jiftachs Tochter ganz anders.<br />
»Obwohl sie nie einen Mann erkannt hatte, wurde sie nichtsdestoweniger<br />
zu einer Tradition in IsraeL« In dramatischer Weise ändert