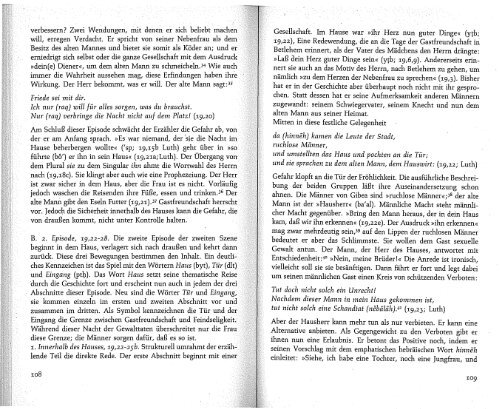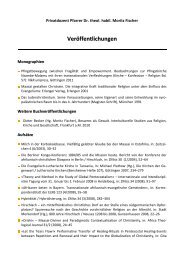Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
verbessern? Zwei Wendungen, mit denen er sich beliebt ma.cm~n<br />
will, erregen Verdacht. Er spricht von seiner Nebenfrau als<br />
Besitz des alten Mannes und bietet sie somit als Köder an; und<br />
erniedrigt sich selbst oder die ganze Gesellschaft mit dem Ausdruck<br />
»dein(e) Diener«, um dem alten Mann zu schmeicheln.34 Wie auch<br />
immer die Wahrheit aussehen mag, diese Erfindungen haben<br />
Wirkung. Der Herr bekommt, was er will. Der alte Mann sagt:3;<br />
Friede sei mit dir.<br />
Ich nur (raq) will für alles sorgen, was du brauchst.<br />
Nur (raq) verbringe die Nacht nicht auf dem Platz! (19,20)<br />
Am Schluß dieser Episode schwächt der Erzähler die Gefahr ab,<br />
der er am Anfang sprach. »Es <strong>war</strong> niemand, der 'sie die Nacht<br />
Hause beherbergen wollte« ('sp; 19,15b Luth) geht über in<br />
führte (bö') er ihn in sein Haus« (19,21a;Luth). Der Übergang<br />
dem Plural sie zu dem Singular ihn ahmt die Wortwahl des<br />
nach (19,18c). Sie klingt aber auch wie eine Prophezeiung. Der<br />
ist z<strong>war</strong> sicher in dem Haus, aber die Frau ist es nicht. VC,rlälUf:ig<br />
jedoch waschen die Reisenden ihre Füße, essen und trinken. 36<br />
alte Mann gibt den Eseln Futter (19,21).37 Gastfreundschaft herrsdlt<br />
vor. Jedoch die Sicherheit innerhalb des Hauses kann die Gefahr,<br />
von drauß~n kommt, nicht unter Kontrolle· halten.<br />
B. 2. Episode, 19,22-28. Die zweite Episode der zweiten<br />
beginnt in dem Haus, verlagert sich nach draußen und kehrt<br />
zurück. Diese drei Bewegungen bestimmen den Inhalt. Ein<br />
ches Kennzeichen ist das Spiel mit den Wörtern Haus (byt), Tür<br />
und Eingang (pt!)l Das Wort Haus setzt seine thematische<br />
durch die Geschichte fort und erscheint nun auch in jedem der<br />
Abschnitte dieser Episode. Neu sind die Wörter Tür und t.n!gang,<br />
sie kommen einzeln im ersten und zweiten Abschnitt vor<br />
zusanunen im dritten. Als Symbol kennzeichnen die Tür und<br />
Eingang die Grenze zwischen Gastfreundschaft und Feind~5eligkl~it:<br />
Während dieser Nacht der Gewalttaten überschreitet nur die<br />
diese Grenze; die Männer sorgen dafür, daß es so ist.<br />
1. Innerhalb des Hauses, 19,22-2Sb. Strukturell umrahmt der<br />
lende Teil die direkte Rede. Der erste Abschnitt beginnt mit<br />
Gesellschaft. Im Hause <strong>war</strong> »ihr Herz nun guter Dinge« (ytb;<br />
19,22), Eine Redewendung, die an die Tage der Gastfreundschaft in<br />
Betlehem erinnert, als der Vater des Mädchens den Herrn drängte:<br />
»Laß Clein Herz guter Dinge sein« (ytb; 19,6,9). Andererseits erinnert<br />
sie auch an das Motiv des Herrn, nach Betlehem zu gehen, um<br />
nämlich »zu dem Herzen der Nebenfrau zu sprechen« (19,3). Bisher<br />
hat er in der Geschichte aber überhaupt noch nicht mit ihr gesprochen.<br />
Statt dessen hat er seine Aufmerksamkeit anderen Männern<br />
zugewandt: seinem Schwiegervater, seinem Knecht und nun dem<br />
alten Mann aus seiner Heimat.<br />
Mitten in diese festliche Gelegenheit<br />
da (hinneh) kamen die Leute der Stadt,<br />
ruchlose Männer,<br />
und umstellten das Haus und pochten an die Tür;<br />
und sie sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt: (19,22; Luth)<br />
Gefahr klopft an die Tür der Fröhlichkeit. Die ausführliche Beschreibung<br />
der beiden Gruppen läßt ihre Auseinandersetzung schon<br />
ahnen. Die Männer von Gibea sind »ruchlose Männer«;3 8 der alte<br />
Mann ist der »Hausherr« (ba'al). Männliche Macht steht männlicher<br />
Macht gegenüber. »Bring den Mann heraus, der in dein Haus<br />
kam, daß wir ihn erkennen« (19,22e). Der Ausdruck »ihn erkennen«<br />
mag z<strong>war</strong> mehrdeutig sein,39 auf den Lippen der ruchlosen Männer<br />
bedeutet er aber das Schlimmste. Sie wollen dem Gast sexuelle<br />
Gewalt antun. Der Mann, der Herr des Hauses, antwortet mit<br />
Entschiedenheit: 40 »Nein, <strong>mein</strong>e Brüder!« Die Anrede ist ironisch,<br />
vielleicht soll sie sie besänftigen. Dann fährt er fort und legt dabei<br />
um seinen männlichen Gast einen Kreis von schützenden Verboten:<br />
Tut doch nicht solch ein Unrecht!<br />
Nachdem dieser Mann in <strong>mein</strong> Haus gekommen ist,<br />
tut nicht solch eine Schandtat (nebäläh}Y (19,23; Luth)<br />
Aber der Hausherr kann mehr tun als nur verbieten. Er kann eine<br />
Alternative anbieten. Als Gegengewicht zu den Verboten gibt er<br />
ihnen nun eine Erlaubnis. Er betont das Positive noch, indem er<br />
seinen Vorschlag mit dem emphatischen hebräischen Wort hinneh<br />
einleitet: »Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und<br />
:108