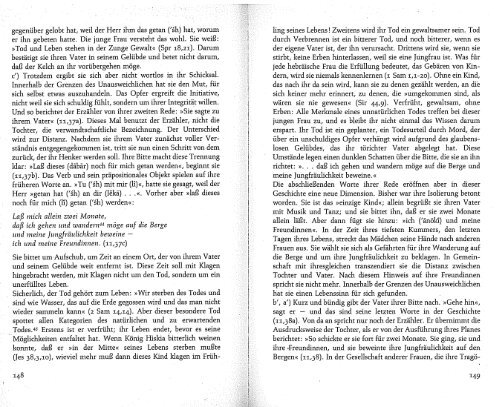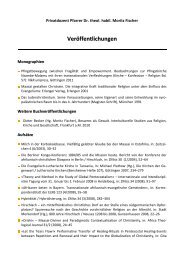Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Trible-mein_gott_war..
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gegenüber gelobt hat, weil der Herr ihm das getan ('sh) hat, worum<br />
er ihn gebeten hatte. Die junge Frau versteht das wohl. Sie weiß:<br />
»Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt« (Spr 1.8,21.). Darum<br />
bestätigt sie ihren Vater in seinem Gelübde und betet nicht darum,<br />
daß der Kelch an ihr vorübergehen möge.<br />
c') Trotzdem ergibt sie sich aber nicht wortlos in ihr Schicksal.<br />
Innerhalb der Grenzen des Unausweichlichen hat sie den Mut, für<br />
sich selbst etwas auszuhandeln. Das Opfer ergreift die Initiative,<br />
nicht weil sie sich schuldig fühlt, sondern um ihrer Integrität willen.<br />
Und so berichtet der Erzähler von ihrer zweiten Rede: »Sie sagte zu<br />
ihrem Vater« (1.1.']7a). Dieses Mal benutzt der Erzähler, nicht die<br />
Tochter, die verwandtschaftliche Bezeichnung. Der Unterschied<br />
wird zur Distanz. Nachdem sie ihrem Vater zunächst voller Verständnis<br />
entgegengekommen ist, tritt sie nun einen Schritt von dem<br />
zurück, der ihr Henker werden soll. Ihre Bitte macht diese Trennung<br />
klar: »Laß dieses (däbär) noch für mich getan werden«, beginnt sie<br />
(1.1.']7b). Das Verb und sein präpositionales Objekt spielen auf ihre<br />
früheren Worte an. »Tu ('sh) mit mir (11)«, hatte sie gesagt, weil der<br />
Herr »getan hat ('sh) an dir (lekä) ...«. Vorher aber »laß dieses<br />
noch für mich (11) getan ('sh) werden«:<br />
Laß mich allein zwei Monate,<br />
daß ich gehen und wandem 44 möge auf die Berge<br />
und <strong>mein</strong>e Jungfräulichkeit beweine -<br />
ich und <strong>mein</strong>e Freundinnen. (1.1.,37C)<br />
Sie bittet umAufschub, um Zeit an einem Ort, der von ihrem Vater<br />
und seinem Gelübde weit entfernt ist. Diese Zeit soll mit Klagen<br />
hingebracht werden, mit Klagen nicht um den Tod, sondern um ein<br />
unerfülltes Leben.<br />
Sicherlich, der Tod gehört zum Leben: »Wir sterben des Todes und<br />
sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht<br />
wieder sammeln kann« (2 Sam 1.4,1.4). Aber dieser besondere Tod<br />
spottet allen Kategorien des natürlichen und zu er<strong>war</strong>tenden<br />
Todes. 45 Erstens ist er verfrüht; ihr Leben endet, bevor es seine<br />
Möglichkeiten entfaltet hat. Wenn König Hiskia bitterlich weinen<br />
konnte, daß er »in der Mitte« seines Lebens sterben mußte<br />
(Jes 38,],1.0), wieviel mehr muß dann dieses Kind klagen im Frühling<br />
seines Lebens! Zweitens wird ihr Tod ein gewaltsamer sein. Tod<br />
durch Verbrennen ist ein bitterer Tod, und noch bitterer, wenn es<br />
der eigene Vater ist, der ihn verursacht. Drittens wird sie, wenn sie<br />
stirbt, keine Erben hinterlassen, weil sie eine Jungfrau ist. Was für<br />
jede hebräische Frau die Erfüllung bedeutet, das Gebären von Kindern,<br />
wird sie niemals kennenlernen (1. Sam 1.,1.-20). Ohne ein Kind,<br />
das nach ihr da sein wird, kann sie zu denen gezählt werden, an die<br />
sich keiner mehr erinnert, zu denen, die >>umgekommen sind, als<br />
wären sie nie gewesen« (Sir 448)' Verfrüht, gewaltsam, ohne<br />
Erben: Alle Merkmale eines unnatürlichen Todes treffen bei dieser<br />
jungen Frau zu, und es bleibt ihr nicht einmal das Wissen darum<br />
erspart. Ihr Tod ist ein geplanter, ein Todesurteil durch Mord, der<br />
über ein unschuldiges Opfer verhängt wird aufgrund des glaubenslosen<br />
Gelübdes, das ihr törichter Vater abgelegt hat. Diese<br />
Umstände legen einen dunklen Schatten über die Bitte, die sie an ihn<br />
richtet: »... daß ich gehen und wandern möge auf die Berge und<br />
<strong>mein</strong>e Jungfräulichkeit beweine.«<br />
Die abschließenden Worte ihrer Rede eröffnen aber in dieser<br />
Geschichte eine neue Dimension. Bisher <strong>war</strong> ihre Isolierung betont<br />
worden. Sie ist das »einzige Kind«; allein begrüßt sie ihren Vater<br />
mit Musik und Tanz; und sie bittet ihn, daß er sie zwei Monate<br />
allein läßt. Aber dann fügt sie hinzu: »ich ('änam) und <strong>mein</strong>e<br />
Freundinnen«. In der Zeit ihres tiefsten Kummers, den letzten<br />
Tagen ihres Lebens, streckt das Mädchen seine Hände nach anderen<br />
Frauen aus. Sie wählt sie sich als Gefährten für ihre Wanderung auf<br />
die Berge und um ihre Jungfräulichkeit zu beklagen. In Ge<strong>mein</strong>schaft<br />
mit ihresgleichen transzendiert sie die Distanz zwischen<br />
Tochter und Vater. Nach diesem Hinweis auf ihre Freundinnen<br />
spricht sie nicht mehr. Innerhalb der Grenzen des Unausweichlichen<br />
hat sie einen Lebenssinn für sich gefunden.<br />
b', a') Kurz und bündig gibt der Vater ihrer Bitte nach. »Gehe hin«,<br />
sagt er und das sind seine letzten Worte in der Geschichte<br />
(1.1.,]8a). Von da an spricht nur noch der Erzähler. Er übernimmt die<br />
Ausdrucksweise der Tochter, als er von der Ausführung ihres Planes<br />
berichtet: »So schickte er sie fort für zwei Monate. Sie ging, sie und<br />
ihre ,Freundinnen, und sie beweinte ihre Jungfräulichkeit auf den<br />
Bergen« (1.1.,]8). In der Gesellschaft anderer Frauen, die ihre Tragö-<br />
1.49