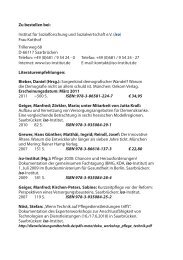Gerontopsychiatrisch veränderte Menschen im Krankenhaus ...
Gerontopsychiatrisch veränderte Menschen im Krankenhaus ...
Gerontopsychiatrisch veränderte Menschen im Krankenhaus ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
führt. Umgekehrt gibt es Hinweise darauf, dass psychiatrisch-psychotherapeutische<br />
Interventionen entsprechend zu einer Kostensenkung beitragen könnten. Hier sind<br />
die Forschungsergebnisse allerdings noch widersprüchlich. Wenn aber derartige Interventionen<br />
z.B. zu einer Verringerung von <strong>Krankenhaus</strong>verweildauern führen sollen,<br />
dann müssen diese offenbar in einem Liaisonansatz verfolgt werden.<br />
Der Unterschied zwischen einem psychiatrischen Liaisondienst bzw. einem Konsiliardienst<br />
ist folgender: be<strong>im</strong> klassischen Konsilmodell wird der Psychiater vom behandelnden<br />
somatischen Arzt gerufen, wogegen er be<strong>im</strong> Liaisonansatz von vorneherein<br />
auf einer definierten regulären Basis an der Versorgung somato-psychisch kranker<br />
Patienten teiln<strong>im</strong>mt. Der Vorteil des Liaisonansatzes liegt darin begründet, dass die<br />
somatischen Ärzte viel zu selten an die Möglichkeit einer psychiatrisch-psychotherapeutischen<br />
Mitbetreuung denken: die relative Konsilrate ist, überraschenderweise<br />
weltweit, nämlich niedrig und liegt bei 1 bis 2 % (<strong>im</strong> Gegensatz zu den vermutlich erforderlichen<br />
10 %, wie dies weiter oben bereits ausgeführt wurde). Man könnte also<br />
sagen, dass <strong>im</strong> klassischen Konsilansatz lediglich die Spitze des Eisbergs psychiatrischer<br />
Komorbidität erkannt wird. Dies lässt sich z.B. am akuten Verwirrtheitszustand<br />
älterer <strong>Menschen</strong> <strong>im</strong> Allgemeinkrankenhaus zeigen: dieser wird nämlich viel zu selten<br />
erkannt, wobei dann wiederum hauptsächlich das sog. hyperaktive Delir auffällt, also<br />
eine Delirform, bei der die Patienten umtriebig und z.B. aggressiv sind. Das ebenfalls<br />
häufige hypoaktive Delir, das sich dadurch auszeichnet, dass die Patienten eher ratlos<br />
<strong>im</strong> Bett liegen, wird dem gegenüber viel zu selten diagnostiziert und häufig als<br />
Depression verkannt. Hier ist die Aufgabe der psychiatrischen Liaisondienste nicht<br />
nur, die Diagnostik und Behandlung dieser Erkrankungsbilder zu verbessern, sondern<br />
durch eine Unterweisung der somatischen Ärzte, aber auch des Pflegepersonals, <strong>im</strong><br />
Gebrauch von einfachen Screening-Methoden frühzeitig auf die Diagnosestellung<br />
und damit bessere Behandelbarkeit solcher Krankheitsbilder vorzubereiten.<br />
Gleichzeitig geht es hierbei allerdings auch darum, Vorurteile gegenüber psychisch<br />
kranken <strong>Menschen</strong>, der Psychiatrie oder aber insgesamt gegenüber älteren <strong>Menschen</strong><br />
zu beseitigen. Einerseits glauben viele somatisch tätige Ärzte und Pflegekräfte<br />
<strong>im</strong>mer noch, dass Psychiatrie gleichzusetzen sei mit der Verwahrung von „auffälligen“<br />
Personen und dass die psychiatrischen Heilbehandlungen letztlich nicht über<br />
die Gabe von Beruhigungsspritzen und das Anlegen von Zwangsjacken hinausgehen.<br />
Hier ist bei vielen <strong>im</strong>mer noch als Modell der alte Film „Einer flog über das Kuckungsnest“<br />
präsent.<br />
Weitere Vorurteile sind aber auch, dass, wenn man selber etwa einen Herzinfarkt erlitten<br />
habe, man dann sicherlich auch depressiv sei. Dies aber ist durch Forschungsergebnisse<br />
eindeutig widerlegt: lediglich ein Prozentsatz von ca. 10 bis 20 % körperlich<br />
kranker Patienten wird <strong>im</strong> Laufe ihrer Erkrankung eine länger anhaltende depressive<br />
Störung erleben. Die Mehrzahl der körperlich kranken Patienten wird vielleicht mit<br />
Ängstlichkeit und trauriger Verst<strong>im</strong>mung auf die Mitteilung der Diagnose einer Krebserkrankung<br />
reagieren, ist dann aber in der Lage, unterstützt durch die eigene Familie,<br />
medizinisches Personal oder auch Selbsthilfegruppen, auch mit prekären Situationen<br />
kompetent und zielgerichtet umzugehen. Dennoch bleibt aber der o.g. Prozentsatz<br />
an Patienten, bei denen dann schließlich eine behandlungsbedürftige psychiatrische<br />
Diagnose gestellt werden muss. Und hier wiederum lässt sich sagen, dass es mittlerweile<br />
über hinreichend methodisch hoch qualifizierte Studien gelingt, die Wirksamkeit<br />
psychiatrisch-psychotherapeutischer, seien es pharmakologische, aber auch psychotherapeutische<br />
Methoden zu belegen.<br />
2