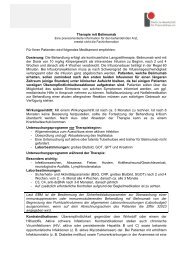Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PODO4-10<br />
Carotidynie bei Takayasu Arteriitis<br />
Schmidt WA., Seipelt E., Krause A., Wernicke D.<br />
Rheumaklinik Berlin-Buch, Immanuel Diakonie Group, Karower Str. 11,<br />
13125 Berlin,<br />
Fragestellung: Der Begriff „Carotidynie“ beschreibt einen Schmerz im<br />
Verlauf der extrakraniellen Arteria carotis. Diff erenzialdiagnostisch ist<br />
an Migräne, Entzündungen im HNO-Bereich und Vaskulitis zu denken.<br />
Kasuistik: Eine 27 jährige Patientin mit dreijähriger Anamnese einer<br />
Takayasu Arteriitis, die sich bisher durch eine Vaskulitis der Aorta<br />
descendens thoracica (Nachweis mittels MRT) und der linken Arteria<br />
subclavia (Nachweis mittels Sonographie, Stent) manifestiert hatte,<br />
klagte über plötzlich aufgetretene Schmerzen an der linken ventralen<br />
Halsseite. Die Krankheit war bis kurz vor diesem Ereignis unter<br />
einer Th erapie mit 125 mg/d Azathioprin und 7 mg/d Prednisolon in<br />
Remission. Klinisch fand sich im schmerzhaft en Bereich eine diskret<br />
tastbare, aber nicht sichtbare Schwellung. Ein Stenosegeräusch war<br />
nicht nachweisbar. Die Entzündungsparameter waren nur gering erhöht<br />
(CRP 8,7 mg/l, BSG 13/28 mm; beide Werte waren 2 Monate zuvor<br />
noch ganz normal gewesen). Sonographisch fand sich eine homogene,<br />
echoarme Arterienwandschwellung in der linken Carotisbifurkation<br />
mit einem Durchmesser bis 4,1 mm ohne hämodynamisch wirksame<br />
Stenose. Eine Th erapie mit täglich 250 mg Methylprednisolon i.v.<br />
wurde 6 Tage nach dem Auft reten der ersten Symptome begonnen.<br />
Nach drei Tagen wurde mit 100 mg/d Prednisolon <strong>für</strong> eine Woche<br />
therapiert, gefolgt von 60 mg/d <strong>für</strong> eine Woche und einer wöchentlichen<br />
Dosisreduktion um 10 mg. Die Schmerzen waren am 2. Tag der<br />
Th erapie deutlich besser und am 4. Tag komplett verschwunden. Der<br />
CRP - Wert war 6 Tage nach Th erapiebeginn wieder normal (1,7 mg/l).<br />
Die sonographisch nachweisbare Echogenität der Wandschwellung<br />
nahm zu (d.h. die Wandschwellung wurde heller), vermutlich durch<br />
Rückgang des Wandödems. Der Durchmesser reduzierte sich auf<br />
2,6 mm nach 4 Tagen und auf 2,2 mm nach 7 Tagen. Nach 3 Wochen<br />
war nur noch eine minimale, echoreiche, umschriebene Wandverdickung<br />
nachweisbar. Der Befund hatte sich nach 8 Wochen komplett<br />
zurück gebildet und war auch ein Jahr später nicht mehr nachweisbar.<br />
Diskussion und Fazit: Das sonographische Korrelat einer Carotidynie<br />
bei Vaskulitis ist eine echoarme Wandschwellung, die sich im Gegensatz<br />
zur chronischen vaskulitischen Arterienwandschwellung bei frühzeitigem<br />
Beginn einer Glukokortikoidtherapie rasch zurückbildet.<br />
PODO4-11<br />
Azathioprin-Infusionstherapie zur Remissionsinduktion<br />
bei mikroskopischer Polyangiitis<br />
Burger S., Natusch A., Kiefer E., Winter E., Krause A.<br />
Rheumaklinik Berlin-Buch, Immanuel Diakonie Group, Karower Str. 11,<br />
13125 Berlin,<br />
Die mikroskopische Polyangiitis gehört neben der Wegenerschen Granulomatose<br />
zu den ANCA-assoziierten Vaskulitiden. Klinisch stehen<br />
die renale und pulmonale Symptomatik meist im Vordergrund. Die<br />
Th erapie erfolgt prinzipiell nach dem Schema einer anfänglichen Induktionstherapie,<br />
welche von einer Remissionserhaltungstherapie gefolgt<br />
wird. Eine Eskalationstherapie wird in refraktären Fällen durchgeführt.<br />
Wir berichten über eine 44jährige Patientin, die vor 14 Jahren an einer<br />
mikroskopischen Polyangiitis erkrankte. Im Vordergrund steht eine<br />
pulmonale Symptomatik mit alveolitischen und infi ltrativen Veränderungen<br />
im CT. Im Verlauf bildeten sich Kavernen aus. Arthralgien, Myalgien<br />
sowie Hinweise auf eine neurologische Beteiligung (Vaskulitisherd<br />
im Pedunculus cerebelli sowie sensible axonale Polyneuropathie)<br />
kamen hinzu. Die Diagnose wurde durch den Nachweis von p-ANCA<br />
(Anti-MPO) und den histologischen Nachweis nekrotisierender vaskulitischer<br />
Veränderungen in der Haut gestützt.<br />
Zur Remissionsinduktion wurde zunächst Cyclophosphamid oral und<br />
i.v. eingesetzt. Darunter kam es zu einer ausgeprägten pneumonitischen<br />
Verschlechterung der pulmonalen Situation. Diese Veränderung ist als<br />
seltene Komplikation der Cyclophosphamidtherapie beschrieben. Die<br />
hochdosierte Prednisolongabe führte zur Besserung der Symptomatik.<br />
Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche Immunsuppressiva zum Erhalt<br />
des Th erapieeff ekts eingesetzt: Azathioprin, Lefl unomid, Ciclosporin,<br />
Mycophenolatmofetil, Infl iximab, Etanercept (z.T. in Kombination).<br />
Nach Reduktion der Prednisolondosis unter 20 mg/d kam es jeweils<br />
zur Exazerbation der pulmonalen Symptomatik mit Zunahme der Entzündungszeichen<br />
und Verschlechterung der Lungenfunktion.<br />
Schließlich verabreichten wir Azathioprininfusionen. Die Patientin erhielt<br />
1200 bis 1800 mg über 36 h intravenös. Die Behandlung wurde in<br />
vierwöchigen Abständen wiederholt und nach der sechsten Applikation<br />
beendet. In Woche zwei und drei nach der Infusion nahm die Patientin<br />
100 mg Azathioprin pro Tag oral ein. Auf Azathioprin-Tabletten<br />
wurde sie auch nach Abschluss der Infusionsserie wieder eingestellt.<br />
Das Behandlungsergebnis war befriedigend. Im Th orax-CT zeigte die<br />
entzündliche Aktivität rückläufi ge Tendenz. Die Lungenfunktion verbesserte<br />
sich. Die Prednisolondosis konnte erstmals seit Jahren auf unter<br />
10 mg/d reduziert werden.<br />
Über die Behandlung therapieresistenter Fälle von Auto immunerkrankungen<br />
mit einer intravenösen Azathioprin-Bolustherapie fi nden<br />
sich in der Literatur zahlreiche Mitteilungen. Insbesondere wurde<br />
über den Einsatz dieser Th erapieoption bei Patienten mit Wegenerscher<br />
Granulomatose, Lupusnephritis, Rheumatoider Arthritis, Colitis<br />
ulcerosa und Spondylitis ankylosans berichtet. Einen Fall von intravenöser<br />
Azathioprintherapie bei einer Patientin mit mikroskopischer<br />
Polyangiitis fanden wir bei unseren Literaturrecherchen bisher nicht.<br />
PODO4-12<br />
Fehlinterpretation eines M. Wegener als Mittelliniegranulom<br />
Schwerdt C. 1 , Keyßer G. 2 , Holl-Ullrich 3<br />
1 Innere Klinik, Städtisches Klinikum Dessau, Auenweg 38, 06842 Dessau,<br />
2 Universität Halle, Medizinische Klinik I, Ernst Grube Str. 40, 06120 Halle,<br />
3 Universität Kiel, Campus Lübeck, Razeburger Allee 160, 23538 Lübeck<br />
Es soll die Krankengeschichte eines 60 jährigen Mannes vorgestellt<br />
werden, der erstmals 6/1993 wegen granulomatöser Veränderungen<br />
der Nasenschleimhaut durch die Fachkollegen <strong>für</strong> HNO als malignes<br />
Mittelliniengranulom therapiert wurde. Unter Cyclophosphamid oral<br />
und systemischer Kortisiontherapie wurden Schubsymptome einer<br />
granulomatösen Erkrankung über viele Jahre gut beherrscht. 2001 entwickelte<br />
der Patient bei einer Gesamtdosis von 100 g Cylophosphamid<br />
ein Blasenkarzinom. Durch eine spezifi sche Instillationsbehandlung<br />
konnte aktuell eine Remission erzielt werden.<br />
Im Dezember 2005 stellt sich der Patient mit massiver Dyspnoe und<br />
blutigem Auswurf in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums<br />
Dessau vor. Aufgrund der Schwere der Symptomatik wurde eine notfallmäßige<br />
thorakale CT und eine Bronchoskopie veranlasst. Die CT<br />
Befunde sprechen <strong>für</strong> eine pulmonale Beteiligung bei Verdacht auf<br />
eine Vasculitis. Die Bronchoskopie weist eine schwere Tracheitis wie<br />
bei M. Wegener nach. Histologisch wird eine ulceröse Bronchitis, eine<br />
erosive Tracheitis sowie ein gering fi brosiertes peripheres Lungenparenchym<br />
beschrieben. Bei bisher fehlendem ANCA Nachweis und<br />
bisher lediglich HNO-Beteiligung wurde bisher ein M Wegener diff erantialdiagnostisch<br />
nicht in Betracht gezogen. Aufgrund der pulmonalen<br />
Manifestation und der Erkrankungsdauer, wurden alle uns zur<br />
Verfügung stehenden histologischen Präparate nochmals referenzpathologisch<br />
durch die Pathologie der Universität Kiel, Campus Lübeck<br />
beurteilt und trotz Fehlen eindeutiger Granulome oder landkartenartiger<br />
Nekrosen im Sinne eines M. Wegener interpretiert.<br />
Das letales Mittelliniengranulom ist eine limitierte Form der lymphomatoiden<br />
Granulomatose, die als ein angiozentrischer lymphoproliferativer<br />
Prozeß defi niert wird. Histologisch fi ndet sich eine Trias aus<br />
Granulomatose, polymorphen lymphozytären Infi ltraten und Angiitis.<br />
<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong> · <strong>Supplement</strong> 1 · 2006 | S51