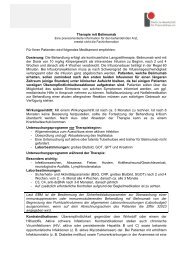Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Zeitschrift für Rheumatologie – Supplement 1 - Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S52<br />
Abstracts<br />
Immunhistochemisch kann die lymphomatoide Granulomatose den<br />
peripheren T- Zell-Lymphomen zugeordnet werden. In der Literatur<br />
wird ein mittleres Überleben bei Patienten mit malignem Mittelliniengranulom<br />
von ca. 9 Jahren angegeben. Die Tatsache, das unser Patient<br />
bereits 12 1/2 Jahre mit dieser Erkrankung lebte, ließ Zweifel an der<br />
primären Diagnose aufk ommen. Dass immer wieder Schubsymptome<br />
eintraten, ist am ehesten der intermittierenden Immunsuppression<br />
ohne remissionserhaltende Th erapie anzuschuldigen.<br />
In der jetzigen akuten Phase wählten wir eine Induktionstherapie aus<br />
Kortisonbolusgabe und Azathioprin in einer Dosierung von 5 mg/<br />
kg KG. Eine erneute Schubsymptomatik ließ sich bisher nicht nachweisen.<br />
PODO4-13<br />
Manifestation einer Riesenzellarteriitis während eines stationären<br />
Aufenthaltes<br />
Sander O., Chehab G., Schneider M.<br />
Rheumazentrum Klinik <strong>für</strong> Endokrinologie, Diabetologie und <strong>Rheumatologie</strong>,<br />
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf<br />
Uns ist bisher kein Fall bekannt, der die Zeitspanne von Symptomfreiheit<br />
und normalen systemischen Entzündungsparametern bis zum<br />
Vollbild einer Riesenzellarteriitis dokumentieren konnte.<br />
Eine 75jährige Patientin wurde wegen akuten starken Rückenschmerzen,<br />
die in Bauch und Flanke ausstrahlten, stationär aufgenommen.<br />
Es waren zahlreiche Begleiterkrankungen bekannt: Polyposis<br />
intestinalis, eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifi kanz<br />
(IgG Lamda), ein Diabetes mellitus Typ II mit diabetischer Mikro- und<br />
Makroangiopathie, Retinopathie und Neuropathie sowie eine 2-Gefäß-<br />
KHK mit Z. n. Vorderwandinfarkt 1984. In umfangreicher Diagnostik<br />
konnten Myocard- und Darmischämien ausgeschlossen werden. Es<br />
wurden frische osteoporotische Sinterungsfrakturen an verschiedenen<br />
BWK gesichert. Unter parenteralen Bisphosphonaten, Physiotherapie<br />
und Analgesie waren die Beschwerden gut rückläufi g, die Patientin<br />
wieder mobil. Ein Plasmozytom war zudem radiologisch wie histologisch<br />
nicht nachweisbar.<br />
Vor der geplanten Entlassung zeigte die Patientin dann erstmals erhöhte<br />
systemische Entzündungsparameter ohne klinisches Korrelat.<br />
Die Werte verdoppelten sich alle 2 Tage, eine Infektfokus konnte nicht<br />
gesichert werden.<br />
Nach 6 Tagen beklagte die Patientin erstmals Kopfschmerzen und am<br />
7. Tag Schläfenschmerzen. Das CRP war mittlerweile auf 11 mg/dl angestiegen<br />
ohne Anzeichen eines anderen Fokus. Dopplersonographisch<br />
konnte eine umschriebene echoarme Wandverdickung des Stirnastes<br />
der linken A. temporalis mit Gefäßokklusion über 1cm gesehen werden<br />
sowie eine echoarme segmentale Wandverdickung der A. axillaris<br />
beidseits. Der Visus war rechts mit 0,6 und links mit 0,4 zu den Vorbefunden<br />
vermindert. Histologisch konnte eine Riesenzellarteriitis in<br />
dem betroff enen Segment mit subtotaler Gefäßlumenstenose gesichert<br />
werden.<br />
Es erfolgte eine umgehende Steroidtherapie mit initial 100mg Prednisolon<br />
und 1mg/kg an den Folgetagen. Die systemischen Entzündungsparameter<br />
waren rasch normalisiert, die Kopfschmerzen sistierten und<br />
der Visus besserte sich auf 0,8/0,6.<br />
Eine fl oride Riesenzellarteriitis entwickelt sich off ensichtlich in wenigen<br />
Tagen. Acht Tage nach dem letzten Nachweis eines normalen<br />
CRP und zwei Tage nach den ersten subjektiven Beschwerden konnte<br />
eine hochfl oride Vaskulitis dokumentiert werden, die bereits zu sonographisch<br />
nachweisbaren Wandverdickungen, beginnendem Gefäßverschluss<br />
und (reversibler) Visus minderung geführt hatte.<br />
| <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Rheumatologie</strong> · <strong>Supplement</strong> 1 · 2006<br />
PODO4-14<br />
Sonographie und F-18-FDG PET in der Diff erenzierung von Polymyalgia<br />
rheumatika und Vaskulitis der großen Gefäße<br />
Sander O. 1 , Georgiadis E. 1 , Hautzel H. 2 , Ostendorf B. 1 , Schneider M. 1<br />
1 Rheumazentrum Klinik <strong>für</strong> Endokrinologie, Diabetologie und <strong>Rheumatologie</strong>,<br />
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, 2 Nuklearmedizinische Klinik<br />
(KME), Forschungszentrum Jülich, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf<br />
In den letzten Jahren ist der Stellenwert der Sonographie und der<br />
Ganzkörper F-18-FDG Positronen Emissions Tomographie (PET) in<br />
der Diff erentialdiagnostik entzündlicher Systemerkrankungen stetig<br />
gewachsen. Ziel dieser Untersuchung ist die Beurteilung der Wertigkeit<br />
dieser Verfahren bei Patienten mit erhöhten systemischen Entzündungsparametern<br />
und polymyalgischen Beschwerden, die nicht<br />
off ensichtlich durch eine andere Erkrankung wie Infektionen oder eine<br />
Rheumatoide Arthritis erklärbar sind.<br />
Methode: Bei Patienten mit erhöhten systemischen Entzündungsparametern,<br />
die sich zur weiteren Abklärung in der <strong>Rheumatologie</strong> vorstellen,<br />
werden klinische Beschwerden wie proximal betonte Muskelschmerzen<br />
und Muskelschwäche, Gewichtsverlust, neu aufgetretene<br />
Kopfschmerzen oder Sehstörungen, die Sonographie der Temporalarterien<br />
und der Gefäße des Aortenbogens, die PET und vorliegende<br />
weitere Befunde (Histologie, Angiographie) ausgewertet.<br />
Ergebnis: In den letzten 24 Monaten konnten 160 Patienten ausgewertet<br />
werden. Bei 51 (32%) Patienten wurde sonographisch eine Vaskulitis<br />
der großen Gefäße diagnostiziert. Die in der Sonographie der Gefäße<br />
dargestellte entzündliche Wandverdickung konnte in histologischen<br />
Proben (der Temporalarterie) und der PET (des Aortenbogens) stets<br />
nachvollzogen werden. Andererseits konnte bei keinem Patienten ohne<br />
Wandveränderungen in der Sonographie klinisch, histologisch oder<br />
in der PET eine Vaskulitis der großen Gefäße nachgewiesen werden.<br />
Die Angiographie konnte bei unseren Patienten lediglich die resultierenden<br />
segmentalen Stenosen bzw. Verschlüsse nach längerem Verlauf<br />
darstellen. Kopfschmerzen, Sehstörungen und Gewichtsverlust korrelierten<br />
mit einem Temporalarterienbefall, die klinischen Parameter<br />
halfen aber nicht zwischen einer Arteriitis anderer Regionen und anderen<br />
Erkrankungen zu diff erenzieren. Bei 77 (48%) Patienten konnte<br />
im Rahmen der Diagnostik eine andere Diagnose gesichert werden, bei<br />
7 Patienten ein Malignom. Bei den verbleibenden 32 Patienten (20%)<br />
ist die klinische Diagnose einer PMR gerechtfertigt.<br />
Zusammenfassung: Sonographie und PET sind eine sinnvolle Ergänzung<br />
der rheumatologischen Diagnostik der Vaskulitiden großer<br />
Gefäße. Mit konsequentem Einsatz ist die Zahl früh entdeckter Fälle<br />
deutlich gestiegen.<br />
PODO4-15<br />
„<strong>Rheumatologie</strong> interaktiv“: Evaluation einer neuen Aus- und Weiterbildung<br />
<strong>für</strong> Studenten und Ärzte durch Team-basiertes Lernen<br />
Witt MN., Schewe S.<br />
Medizinische Poliklinik LMU, Rheuma-Einheit<br />
An der Rheuma-Einheit der LMU München wurden in 18 Monaten<br />
über 140 Studenten und über 60 Ärzte mit einer neuen Form der Aus-<br />
und Weiterbildung unterrichtet. Dabei wurden anhand eines fall-basierten<br />
Lernmodells zunächst multiple-choice-Fragen zu 3 typischen<br />
Fällen aus dem Gebiet der internistischen <strong>Rheumatologie</strong> individuell<br />
bearbeitet. Anschließend wurden die Antworten der Teilnehmer in<br />
Kleingruppen von maximal 6 Personen diskutiert und ggf. nochmal<br />
modifi ziert. Abschließend wurden die in der Kleingruppe gemeinsam<br />
erarbeiteten Antworten mit den Antworteten anderer Gruppen verglichen<br />
und unterschiedliche Antworten erneut diskutiert.<br />
Durch diesen Ansatz soll die im klinischen Alltag bewährte und regelmäßig<br />
praktizierte Diskussion unter Kollegen in eine Lehrveranstaltung<br />
übertragen werden. Gerade Studenten und junge Kollegen<br />
können so verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfi ndung in<br />
Bezug auf Diagnostik und Th erapie nachvollziehen, die in der Praxis